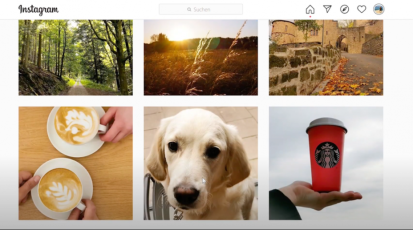Dieses Bild kann sie nicht vergessen, wie dieser Soldat mit dem Stiefel sie zur Seite geschoben hat und Papa rausgeführt hat. Das war in Mama so tief verwurzelt.
Heimweh
März 1988, Moskauer Flughafen – Andreas kommt mit einem Lächeln auf seine Familie zu. Endlich! Es geht nach Hause. Ein Ort, an dem sie noch nie waren, der für sie aber immer Heimat war. Sie konnten einen Platz im Flugzeug nach Düsseldorf bekommen. Es ist 22 Uhr. Zwei volle Nächte verbrachten sie mit fünf Kindern auf dem Flughafen, auf Stühlen, und warteten auf ihren Flieger nach Deutschland. Andreas, das ist mein Opa, Lilli, meine Oma. Sie ist damals mit dem sechsten Kind hochschwanger, müde vom Sitzen und doch voller Hoffnung auf das Leben, das vor ihnen liegt. Die ganze Familie steigt erschöpft ins Flugzeug, es ist eine Maschine aus Deutschland, Lufthansa steht darauf. Mit einem Lächeln im Gesicht kommt ihnen die Stewardess entgegen, bietet ihnen an, das Gepäck abzunehmen und verlegt die Familie in die erste Reihe. Dort hätten sie Platz, um die Füße auszustrecken. Die Stewardess bringt den Kindern Spielsachen und etwas zu trinken. Lilli fällt müde und erleichtert in den dunkelblauen Sitz neben ihren zweijährigen Sohn. Sie fängt an zu weinen. „Ich saß da und heulte. Das war sowas, vom Grundsatz her, anderes. Da war nichts so wie zuvor.“
Februar 2022, Aschaffenburg – ich stehe mit Oma in ihrer Küche. Mit einer Schürze um die Hüfte steht sie an der Spüle, das Geschirr hat sie gerade abgewaschen und ich kann Tränen in ihren Augen sehen. Noch nie habe ich meine Oma so gesehen. Ich verstehe, wie tief diese Szene in ihrem Kopf verwurzelt ist, und welche Bedeutung dieser Moment für sie bis heute hat. „Wir sind weggeflogen und ich hab mich kein einziges Mal umgeschaut. Ich hab zu meinem Herrn gesagt, so möchte ich von dieser Erde gehen.“
Hoffnung auf ein besseres Leben
Meine Oma ist eine Russlanddeutsche. So werden die Deutschen genannt, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ins russische Zarenreich auswanderten. 1763 definiert den Beginn einer riesigen Auswanderungsbewegung. Die russische Kaiserin Katharina II. verbreitet damals ein Einladungsmanifest, das die Ansiedlung im russischen Reich für Ausländer attraktiv machen soll. So werden den Siedlern unter anderem Steuervergünstigungen, eine Befreiung vom Militärdienst, Sprachfreiheit und freie Religionsausübung versprochen. Bereits in den ersten fünf Jahren nach 1763 kommen 30 000 Deutsche ins russische Reich.
Auch die Vorfahren meiner Oma zählen zu ihnen. Sie wandern wegen ihres Glaubens aus. Als Mennonit*innen ist es ihnen verboten, zum Militär zu gehen und Waffen zu benutzen. Doch in Deutschland ist der Militärdienst Pflicht. Also gehen sie in die Ukraine, siedeln sich dort an und leben als Bauern in einem deutschen Dorf mit einer deutschen Schule. Ein gutes Leben führen sie dort. „Meine Oma, die hat immer sehr begeistert erzählt von den deutschen Dörfern in der Ukraine“, erklärt mir Oma mit einem Lächeln im Gesicht.
Doch zur Zeit des ersten Weltkriegs ändert sich das Leben für die Russlanddeutschen schlagartig. Die Russen sehen in den Deutschen einen inneren Feind, verbieten die deutsche Sprache, enteignen die reichen Bauern und deportieren tausende deutsche Staatsangehörige. Die Situation wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Mit der Machteroberung Hitlers wird die Angst der Sowjets vor den Russlanddeutschen immer größer. Sie befürchten, dass die Nazis in die Ukraine einmarschieren und die deutsche Bevölkerung für ihre Eroberungszüge instrumentalisieren wollen.
Vertrieben, verhaftet, vernichtet
Ab 1937 verhaften und töten die Sowjets tausende Russlanddeutsche, die in der Rüstungs- und Transportbranche tätig sind. Doch schnell werden auch diejenigen verhaftet, die Mitarbeitende deutscher Firmen sind, Soldaten, die während des ersten Weltkriegs in deutscher oder österreichischer Gefangenschaft waren, Menschen, die Briefwechsel mit Verwandten im Ausland führen und sogar sowjetische Bürger*innen, die dem Regime aus ihrer Sicht zu kritisch gegenüberstehen. Allein in den Jahren 1937 und 1938 werden über 1,3 Millionen Menschen von der sowjetischen Justiz verurteilt und 700 000 erschossen.
1937, Ukraine – Omas Mama Nina ist zehn, ihre kleine Schwester sieben, als sowjetische Soldaten in ihr Zuhause einfallen und ihren Papa Cornelius verhaften. Er dreht sich noch hilflos zu seinen Töchtern um, um sich zu verabschieden. Doch die Soldaten zeigen kein Mitleid und halten ihn brutal zurück. In dem Moment fällt die Mama der Mädchen, Helene, zu Boden und erleidet einen epileptischen Anfall. Schaum kommt aus ihrem Mund, die Mädchen stehen daneben und schreien. Die Soldaten schieben Helene mit dem Fuß weg und verlassen das Haus. Ihren Papa werden Nina und ihre Schwester nie wieder sehen.
„Dieses Bild kann sie nicht vergessen, wie dieser Soldat mit dem Stiefel sie zur Seite geschoben und Papa abgeführt hat. Das war in Mama so tief verwurzelt“, erklärt mir Oma seufzend. Man merkt, wie sehr sie diese Geschichte geprägt hat.
In den Jahren nach 1937 nimmt die Zahl der Verhaftungen und Deportationen stetig zu. Bis Ende 1941 werden 900 000 Deutsche zwangsweise umgesiedelt. Auch Nina und ihre verbliebene Familie werden davon nicht verschont. 1941 werden sie in Viehwaggons nach Kasachstan deportiert. Eine Pferdefuhre an Besitz dürfen sie mitnehmen, den Rest vergraben sie im Garten. Sie hoffen, dass sie nach dem Krieg zurückkommen. Doch dazu wird es nie kommen. Drei Monate verbringen sie im Zug mit vielen anderen Vertriebenen, ein Eimer in der Ecke des Waggons dient als Toilette. Bei -20 Grad werden sie in Kasachstan aus dem Zug gejagt. Es ist tiefster Winter, der Fluss nebenan ist zugefroren, weit und breit keine Menschenseele. Sie bauen sich Iglus im Schnee, um nicht zu erfrieren. Doch am nächsten Morgen kann man das Weinen der Menschen schon von Weitem hören, viele Alte und Babys sind durch die grausamen Temperaturen erfroren. Erst nach Tagen kommen Kasachen mit Pferdeschlitten und nehmen sie mit in ihre Dörfer. Nina wird in einer kasachischen Familie untergebracht, sie lernt ein Mädchen kennen und bringt ihr Plattdeutsch bei – die Sprache ihrer Heimat. Bis zum Sommer 1942 dürfen sie dort leben.
Dann werden Nina und ihre Mama zur Arbeitsarmee berufen. Die gerade einmal elfjährige kleinere Schwester Vala soll alleine zurückbleiben, sie ist noch nicht arbeitsfähig.
Ein Leben im Lager
Meine Oma erzählt: „Meine Oma (Helene) hat eine Kiste gemacht, hat dort Löcher gemacht zum Atmen, hat sie dort reingesteckt und hat sie zugedeckt mit verschiedenem Zeug.“ Helene schmuggelt ihre kleine Tochter im Zug mit, ihre Essensrationen sind nur für zwei bemessen, doch das nehmen sie in Kauf. Die kleine Familie wird nach Sibirien in ein sowjetisches Arbeitslager verschleppt.
1942, Workuta im Norden Russlands – Dort angekommen, nimmt man ihnen die Papiere weg und verteilt sie auf Baracken. Hier schlafen sie, dicht an dicht. Privatsphäre existiert nicht. Einmal die Woche dürfen sie sich baden, danach bekommen sie frische Klamotten – eine mit Watte ausgestopfte Hose und eine Jacke für jede*n. Um das Lager herum befinden sich tiefe Wälder und Moor, Fluchtversuche scheitern im Winter an der eisigen Kälte, im Sommer am unüberwindbaren Moor. Nina muss mit ihren 15 Jahren unter Tage arbeiten. Früh am Morgen geht es für sie in die dunklen Schächte der Kohlegrube, abends kommt sie erschöpft und hungrig zurück. Meist gibt es für die Arbeitenden Brot und Wasser, an guten Tagen gibt es eine Suppe. Ihr fehlen lebenswichtige Nährstoffe. Nina wird krank von der Arbeit, ihre Beine können sie nicht mehr tragen. Eine jüdische Ärztin bringt sie ins Krankenlazarett und versorgt sie mit Vitaminen. Nina kommt wieder auf die Beine, in die Kohlegrube muss sie fortan nicht mehr, stattdessen wird sie zum Holzfällen eingesetzt.
Nach dem Krieg veranstalten die jungen Gefangenen Tanzabende. Dort lernt Nina 1947 einen jungen Mann kennen und verliebt sich. Die beiden heiraten und bekommen im Laufe ihrer Gefangenschaft vier Kinder, 1949 kommt meine Oma zur Welt. Insgesamt befinden sich Nina, Vala und ihre Mutter Helene 14 Jahre in Zwangsarbeit. Dabei wechseln sie immer wieder den Ort. Mit der Zeit verbessern sich ihre Unterkünfte und in den 1950er Jahren erhalten sie sogar ein Gehalt. Doch der Zwangsarbeit entkommen sie erst 1956.
Zehn Jahre zuvor, 1946, wird die Arbeitsarmee offiziell abgeschafft. Die Lager werden in sogenannte Sondersiedlungen umbenannt. Ein Dekret des Obersten Sowjets aus dem Jahr 1948 bestraft das Entfernen aus den Sondersiedlungen mit bis zu 20 Jahren Zwangsarbeit. So behandeln die Sowjets die Russlanddeutschen auch nach Kriegsende noch wie Arbeitssklaven. Erst 1955 erhalten die Deutschen nach und nach ihre Pässe, um die Siedlungen verlassen zu können. Ihr Vermögen aus der Zeit vor dem Krieg sehen sie nie wieder, genauso wie ihre Heimat. Helene und ihre Töchter müssen unterschreiben, die Ukraine nie wieder zu betreten.
Der Anfang vom Ende
Die Familie zieht nach Saran in Kasachstan. Meine Oma absolviert die Schule, macht eine Ausbildung zur Apothekenhelferin und lernt in ihrer Kirchengemeinde meinen Opa kennen. Die beiden heiraten und bauen sich ein Leben in Saran auf. Doch für meine Oma ist immer klar – ihre Heimat ist in Deutschland. „Zu unserer Zeit, als Oma uns die ganzen Geschichten erzählte, hat sie gesagt: Es wird eine Zeit kommen und dann dürft ihr nach Deutschland. Diesen Moment dürft ihr nie verpassen“, erzählt mir meine Oma. Dieser Traum ist in ihr eingefleischt, doch sie rechnet nicht damit, dass dieser Tag jemals kommen wird.
1987, Kasachstan – Omas Bruder Peter erhält nach vielen Versuchen die Erlaubnis, nach Kanada auszuwandern. Am selben Tag, an dem seine Ausreise genehmigt wird, stirbt Helene nach langer Krankheit. Es ist, als wüsste sie, dass ihre Familie nun endlich nach Hause kann. Peter reist von Kanada nach Deutschland und schickt von dort aus seiner Schwester Lilli eine Einladung. „Man brauchte damals eine Einladung, die von der deutschen und russischen Regierung genehmigt werden musste. Wir konnten nicht einfach nach Deutschland kommen“, klärt mich meine Oma auf. Als die Einladung genehmigt wird, überlegen meine Großeltern keine Sekunde. Sie packen ihre Koffer, lassen ihren Besitz zurück und wandern im März 1988 nach Deutschland aus. Sie dürfen in eine 93 Quadratmeter große Sozialwohnung in Aschaffenburg einziehen – ein Paradies für die Familie.
2022, Aschaffenburg – Drei Stunden hat mir Oma vom Leben ihrer Oma, dem ihrer Mama und von ihrem eigenen Leben erzählt. Die Brotzeit vor mir kommt mir auf einmal vor wie das Abendmenü eines Sternekochs. Die Kuckucksuhr an der Wand vor mir schwingt von rechts nach links, tick…tack…tick…tack. Die Bilder daneben zeigen Mama und Papa, meine Onkel und Tanten. Selten spürte ich eine so tiefe Dankbarkeit wie in diesem Moment. Endlich verstehe ich, warum meine Mama sich schon immer als Deutsche sah, warum sie manchmal sagt, wir seien verwöhnt und warum Kasachstan keine Rolle in meiner Erziehung spielte. Ich schäme mich für meine geringe Wertschätzung für alles, was ich habe und danke Gott für meine Familie, mein luxuriöses Leben und diese Geschichte.
Anmerkung: Die Szenen wie z.B. die Verhaftung meines Ur-Ur-Großvaters oder die Deportation im Zug wurden mündlich von Generation zu Generation weitererzählt und konnten deshalb von mir nicht überprüft werden.