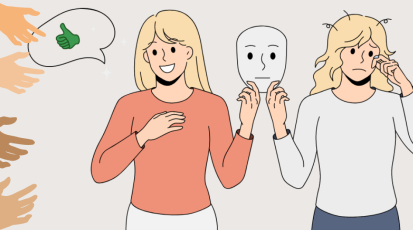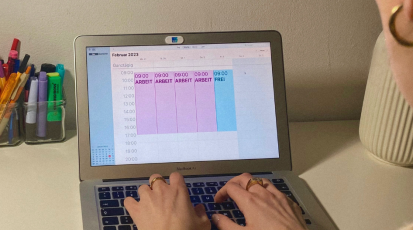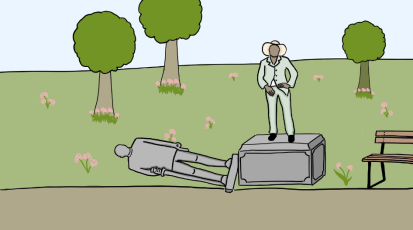„Es ging mir nicht nur ums Sichtbarmachen, sondern darum, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, die mir bei 'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo' gefehlt hat.“
„Ich glaube, das waren die längsten zwei Minuten meines Lebens“

Isabell Beers Steckenpferd sind Online-Recherchen. Die führt sie zum Teil verdeckt durch. Mit Anfang 20 wurde sie gleich für ihr erstes großes Rechercheprojekt für den Deutschen Reporterpreis nominiert. Isabell war unter anderem für „die Zeit“ tätig und arbeitet heute bei „STRG_F“ – einem Format von „Funk“.
Eine ihrer Online-Recherchen bewegt sie dazu, ein Buch mit dem Titel „Bis einer stirbt“ zu schreiben. Es handelt von zwei Jugendlichen, Josh und Leyla (die eigentlich anders heißt), die in die Drogenszene abrutschen. Josh stirbt schließlich an einer Überdosis. Isabell begann mit der Recherche, als Josh ungefähr ein Jahr tot war.
Leyla hat dich während eures ersten Treffens gefragt hat, ob du ihr beim Drogenkonsum zusehen möchtest. Wie geht man mit so einer Situation um?
Damit habe ich null gerechnet, weil sie meinte, dass sie weitgehend clean ist. Während des Interviews habe ich dann aber gemerkt, dass das nicht ganz stimmt. Sie meinte dann zu mir: „Komm mit, wenn du mich konsumieren sehen willst“ und ich bin ihr auf die Toilette eines Cafés gefolgt. Die Frage, die ich mir damals gestellt habe, war, ob sie das jetzt nur machen will, weil ich dabei bin. Dann habe ich erst mal meinen Chef angerufen und ihn nicht erreicht. Ich war sehr unsicher in dem Moment. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll das allein machen und ich warte vor der Kabine.
Ich glaube, das waren die längsten zwei Minuten meines Lebens. Weil ich einfach total Angst hatte, dass sie bewusstlos wird. Das ist aber zum Glück nicht passiert. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass Leyla zu dem Zeitpunkt abhängig war. Ich denke, in solchen Situationen ist es gut, auf sein Bauchgefühl zu hören.
Isabells Buch befasst sich mit der Drogenszene im Internet und zeigt, wie Jugendliche einander zum Konsum animieren. Einer dieser Jugendlichen ist Josh. Er ist drogenabhängig und tritt bereits mit 17 Jahren ersten Konsum-Gruppen auf Facebook bei. Dort lernt er Leyla kennen, die selbst heroinabhängig ist.
Hast du während deiner Recherchen schon mal sowas, wie ein Helfersyndrom gehabt?
Wenn ich merke, mich triggert ein Thema sehr, weil es etwas mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, dann gebe ich es an jemand anderen ab. Schließlich tut man sich selbst und der Recherche keinen Gefallen, wenn man es dann trotzdem macht. Bei manchen Recherchen habe ich psychologisches Coaching in Anspruch genommen, um mich besser abzugrenzen. Das hat für mich bislang gut funktioniert. Ich finde es weniger schwierig, gesunden Abstand zu wahren, wenn ich online recherchiere. Schwieriger wird es für mich dann eher, wenn ich im direkten Kontakt mit jemanden stehe und merke, die Person hat immense Probleme.
Ich hatte mal so einen Fall. Da hat mir eine Jugendliche immer wieder Nachrichten geschickt, in denen sie gesagt hat, wie schlecht es ihr geht. Da habe ich schnell geschaut, dass ich mir Rat hole. Ich habe mich bei einer Expertin gemeldet und an eine Person gewandt, die selbst mal in einer ähnlichen Situation war. Beide habe ich gefragt: „Was kann man in so einem Fall machen? Welche Worte wähle ich, um eine gesunde Distanz wahren zu können?“. Dieser Austausch hat mir sehr geholfen. Ich habe mir dann auch teilweise mit dem Antworten Zeit gelassen, wenn ich überhaupt nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Und habe mir bewusst gemacht; „Alle Hilfestellungen, die mir eingefallen sind, habe ich weitergegeben. Ich habe eine klare Grenze gezogen. Die Person sagt selbst, dass sie im Moment keine Hilfe möchte. Mehr kann ich nicht tun."
Wie verhält man sich im Interview mit Personen, die noch in einem Trauerprozess stecken?
Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber wenn man empathisch bleibt, nach den Bedürfnissen schaut und transparent kommuniziert, hilft das beiden Seiten schon viel. Mich berühren solche emotionalen Interviews natürlich. Aber ich mache mir dann klar, dass es der anderen Person nichts bringt, wenn ich auch anfange zu weinen. Und ich möchte den Menschen den Raum geben, den sie brauchen.
Gleichzeitig möchte ich ihre Geschichte erfahren und später erzählen. In so einer Situation sage ich immer, dass wir jederzeit eine Pause machen können. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich immer Taschentücher dabeihabe, die ich dann sichtbar auslege. Damit die Leute merken, dass es nicht das erste Mal ist, dass jemand in einem Interview weint. Und, dass das okay ist.
Wie wahrst du diese gesunde Distanz?
Ich finde es wichtig, die eigene Rolle klarzumachen. Ich bin zu bestimmten Zeiten erreichbar. Ich habe extra eine Handynummer nur für Recherche-Kontakte. Wenn ich zum Beispiel merke, dass jemand den näheren Kontakt zu mir sucht, dann verweise ich direkt auf Organisationen und Orte, die Hilfe anbieten. Damit klar wird, dass ich das nicht leisten kann.
Hast du das von Anfang an so gemacht?
Nein. Anfangs hatte ich eine Nummer, die ich privat und beruflich genutzt habe. Und das war echt ein Problem. Ich hatte nie Feierabend. Ich habe dann angefangen, mir früh eine zweite Nummer zuzulegen. Und inzwischen habe ich mehrere Nummern, für jeden Zweck eine andere. Das funktioniert für mich am besten und hilft mir, zur Ruhe zu kommen.
Im Vorwort deines Buchs schreibst du: „Dieses Buch hat nicht den Anspruch abschreckend zu sein, sondern den, differenzierte Informationen zu liefern“. War das von Anfang an dein Hintergedanke?
Ich habe gemerkt, dass „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ nicht die Wirkung hatte, die vielleicht viele erwartet hätten. Ich habe während meiner Recherchen immer wieder von Leuten, die konsumiert haben, Dinge gehört, wie „Ich habe das gelesen, fand es geil und ich wollte das auch machen“.
Das hat mir anfangs Angst gemacht. Deshalb habe ich Leute hinzugezogen, also Experten aus der Suchthilfe, die mir dann erklärt haben, wie man ein Buch zu dem Thema schreiben kann, das aufklärt. Ich hätte mir zu Beginn zum Beispiel nicht vorstellen können, dass ich am Ende eine Anleitung für „Safer Use“ reinnehme. Das Wichtigste ist, darzustellen, wie es in der Realität ist. Ich persönlich sehe keine einfache Lösung dafür. Aber ich glaube, was schon wichtig ist, sind Einordnungen, wie: Was macht eine Substanz im Körper? Also es ging mir nicht nur ums Sichtbarmachen, sondern darum, diese Aufklärung reinzupacken, die mir bei „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ gefehlt hat.
Wie haben Leyla und Joshs Eltern auf das Buch reagiert?
Sie waren in den Prozess mit eingebunden und es war nicht so, dass ich einfach die Rechercheergebnisse genommen und dann daraus ein Buch gemacht habe. Die Rückmeldungen der Buch-Charaktere und der Angehörigen waren positiv. Das hat mich auch gefreut, weil eine Sorge von mir war natürlich: Jemand erzählt mir so eine persönliche Geschichte und ist dann am Ende unzufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe aber auch während der Arbeit an dem Buch mit Leyla und Joshs Eltern kommuniziert, und auch noch mal nachgefragt, ob ich dieses oder jenes richtig verstanden habe. Das war auch total wichtig. Ich hätte sonst vielleicht Sachen geschrieben, die ganz anders gemeint gewesen sind; die ich sonst anders interpretiert hätte.
Was ist investigativer Journalismus für dich?
Es gibt unterschiedliche Arten von investigativem Journalismus. Es gibt Recherchen, bei denen man Informationen zugespielt bekommt und sich dann durch Akten wühlt. Bei mir ist das seltener der Fall. Ich recherchiere online und stoße dann währenddessen auf Infos. Und das Interessante dabei ist, dass man am Anfang noch gar nicht einschätzen kann, ob das eine investigative Recherche wird oder nicht. Das ergibt sich erst mit der Zeit, je nachdem, wie viel man dazu findet.
Wie läuft die Themenfindung für eine Online-Investigativ-Recherche ab?
Themen finde ich meistens, während ich für andere Sachen recherchiere. Das neue Thema recherchiere ich dann erstmal eine halbe bis zwei Stunden an. Dann gehe ich zu meinen Vorgesetzten und stelle es ihnen vor. Manchmal recherchiere ich aber auch nur eine Viertelstunde und schicke dann schon die ersten Infos. Und wenn das Thema dann interessant für uns ist, gehe ich ihm weiter nach.
Meistens geht es anfangs darum, eine konkrete Frage zu dem Thema zu formulieren. Ich habe aber schon mehrfach festgestellt, dass dann am Ende eigentlich was ganz anderes dabei rauskommt. Meine erste Investigativ-Recherche handelte von Voyeuren, die Frauen heimlich filmen und das dann auf Pornoseiten hochladen. Und da dachte ich anfangs, dass das eine Person macht. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass da ein ganzes Netzwerk dahintersteckt. Dass da noch viel krassere Inhalte sind. Dass die Leute heimlich Kameras an öffentlichen Orten, wie Schwimmbädern, Duschen und so weiter verstecken. Oder sogar bei Frauen zuhause. Das hat sich dann erst während der Recherche gezeigt.
Was ist der Nachteile von Online-Recherchen im Vergleich zu klassischen Vor-Ort-Recherchen?
Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also, wenn es zum Beispiel um Kinder oder Jugendliche und pornografische Inhalte geht, da macht man sich auch als Journalistin sehr schnell strafbar. Man muss sich bewusst sein, dass man zwar vieles, aber nicht alles darf.
Was sind Vorteile?
Vorteile sehe ich zum Beispiel bei Undercover-Recherchen. Eine neue Identität ist online viel einfacher zu erfinden als im realen Leben. Online habe ich mich auch schon als Mann ausgegeben. Das wäre im realen Leben deutlich schwerer. Trotzdem muss das vorher rechtlich abgeklärt und in der Redaktion besprochen werden.
Gab es auch Vorteile der Online-Recherche im Hinblick auf das Schreiben deines Buchs?
Die Online-Recherche-Skills haben mir sehr geholfen. Damals lief noch vieles über Facebook und es gab die „Graph Search“-Funktion: Da konnte man zum Beispiel von bestimmten Nutzern einen bestimmten Post an einem bestimmten Tag suchen. Das war für die Recherche super hilfreich, weil man genau nachschauen konnte, in welchem Verhältnis bestimmte Nutzer zueinanderstehen. Und dann konnte ich vor Interviews prüfen: Was hat Nutzer XY gepostet? Wie wurde miteinander interagiert?
Vor allem, weil man im Interview ja auch nicht immer die Wahrheit gesagt bekommt. Und wenn ich dann am Ende sagen kann, dass ich die Kommentare gelesen habe und weiß, was darin geschrieben wurde, dann kriege ich noch mal andere Informationen.
War es schwer, in die Chatgruppen reinzukommen?
Nein, das war wirklich nicht schwierig. Ich habe mir einfach Fake-Profile angelegt. Es gab eine Gruppe, da war es ein bisschen schwieriger. Die wollten sichergehen, dass man eine reale Person ist. Da habe ich dann ein Foto von mir selbst hochgeladen, auf dem man mein Gesicht nicht richtig gesehen hat. Da wurde auch immer behauptet, dass nur Leute über 18 zugelassen werden. Ich habe zwar immer geantwortet ich sei 18, aber anhand meiner Fotos hätte man jetzt nicht ablesen können, ob ich Mitte 20 oder 14 bin.
Ab welchem Zeitpunkt sollte man als Journalist*in die wahre Identität offenlegen?
Es gibt zwei Dinge, die für eine Undercover-Recherche gegeben sein müssen: Erstens muss die Information von öffentlichem Interesse sein. Zweitens darf man zu dieser Information anderweitig keinen Zugang haben. Meistens sind die Informationen aber über einen anderen Weg zugänglich oder nicht von öffentlichem Interesse. Es gibt also nur wenige Ausnahmefälle, wo man dann wirklich Undercover arbeiten muss. Und da ist es dann natürlich wichtig, die Leute am Ende der Recherche damit zu konfrontieren, die im Beitrag eine Rolle spielen. Sie müssen wissen, wer man ist und eine faire Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern.
Auch interessant
Hast du nach Recherchen das Bedürfnis, dich nochmal bei den Beteiligten zu melden?
In den meisten Fällen habe ich nach einer Recherche keinen Kontakt mehr zu beteiligten Personen. Es kommt aber immer drauf an. Wenn ich jetzt über so einen langen Zeitraum mit jemandem zu tun habe, dann ist es noch mal was anderes. Mit Leyla habe ich bis heute noch Kontakt. Natürlich nicht so intensiv wie, als ich das Buch geschrieben habe, aber ich frage sie immer mal wieder, wie es ihr geht. Manche Leute wollen das irgendwann nicht mehr. Gerade, wenn es zum Beispiel um traumatische Dinge geht. Es gab auch schon Personen, die zu mir gesagt haben, dass sie nicht mehr kontaktiert werden möchten. Und dann ist es auch wichtig, das zu respektieren.
Ab welchem Punkt beendest du deine Recherchen?
Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn mir das niemand sagen würde, dann würde ich immer noch an manchen Recherchen hängen. Meistens arbeitet man im Team und hat zumindest einen Vorgesetzten, der dann auch irgendwann sagt, dass die Recherche jetzt abgeschlossen ist.
Was war dein größtes Learning aus der Zeit der Recherche zu Josh und Leyla?
Ich habe gemerkt, wie sich meine eigene Meinung zum Thema geändert hat, dadurch, dass ich mehr darüber erfahren habe. Drogenszene. Das war eigentlich ein Thema, das mich anfangs gar nicht so richtig interessiert hat. Ich habe auch gemerkt, dass im Journalismus bei diesem Thema sehr viel falsch gemacht wird. Was daran liegt, dass man so unbedarft rangeht – so wie ich am Anfang auch. Gerade beim Thema Drogen finde ich es total wichtig, mit Menschen zu reden, die da selbst auch mit drinstecken. Und nicht einfach nur über sie zu sprechen.
Dieses Interview fand am 17.05.2023 im Rahmen der Gesprächsreihe „Investigativer Journalismus“ statt. Auch das Publikum hatte die Möglichkeit Fragen zu stellen, die an einigen Stellen im Interview auftauchen.