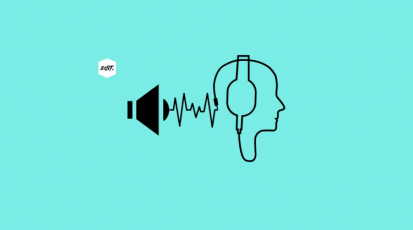Auch wenn es manchmal noch schlimm ist, weiß ich sehr zu schätzen, wie toll alles geworden ist und wie lebensfähig ich wieder bin. Das hätte ich damals nie gedacht.
Ein Leben mit und nach dem Krebs

Sommer 2008: Nach jahrelangen Depressionen wird bei der zweifachen Mutter ein Gehirntumor diagnostiziert. Die gute Nachricht: Der Krebs ist operabel. Bei der lebensrettenden Operation geht jedoch etwas schief und Christina B. erleidet einen Schlaganfall. Der Krebs ist geheilt, die Depressionen verschwunden. Dennoch sind die Folgen gravierend. Laufen, sprechen, leben – all das muss sie erneut lernen.
Was ist aus heutiger Sicht das Wichtigste, das du aus deiner Geschichte gelernt hast?
Dass man auch in negativen Geschichten etwas Positives finden kann, denke ich. Dass jeder Tag ein schöner Tag sein kann, wenn man ihn lebt.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du damals die Diagnose „Gehirntumor“ erhalten hast? Wie hast du dich da gefühlt?
Ich weiß noch, dass ich zu der Zeit schon die vierte oder fünfte Woche in der Pfalz-Klinik war. Dann bin ich nach Landau ins Vinzentius-Krankenhaus geschickt worden, um das MRT vom Kopf zu machen. Ich muss sagen, dass ich an dem Punkt schon dermaßen zugedröhnt mit Tabletten war, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Ich hab‘ ja damals so schlimme Depressionen gehabt, dass ich gar nicht sagen kann, was ich empfunden hab. Wahrscheinlich war ich irgendwie erleichtert, dass sie endlich was gefunden haben.
Dir war damals also noch nicht wirklich klar, was die Diagnose für dich bedeutet – das Bewusstsein hat sich quasi erst über die Zeit eingeschlichen?
Ja, klar. Ich hab‘ ja nur gewusst, dass ich einen Tumor habe. Ich wusste weder, dass er operiert werden soll, noch, was sonst noch auf mich zukommt.
Wie hat damals dein Umfeld auf die Nachricht reagiert?
Mein Ex-Mann hat mir gesagt, dass er damals alles stehen und liegen gelassen hat und nach Freiburg gefahren ist, um gemeinsam mit mir beim Arzt ein Gespräch zu haben. Also der war wahrscheinlich auch sehr schockiert.
Habt ihr auch den Kindern erklärt, was mit dir los ist?
Naja. Der Jüngere war damals ja drei und der Ältere sechs. Mein Ex-Mann hat da gar nichts gesagt. Die wussten nur, dass ich in der Klinik bin, aber von der Operation hat er ihnen, glaube ich, nichts erzählt. Irgendwann später, als es dann ging, dass sie mich besuchen, hat er zwar schon gesagt, dass ich operiert worden bin und alles besser wird, aber so genau hat er’s ihnen eigentlich nie erklärt. Da waren sie aber auch noch zu klein, denke ich.
Glaubst du aber, sie haben verstanden, dass mit ihrer Mutter etwas nicht stimmte?
Also mein älterer Sohn meinte, er hat schon Angst um mich gehabt, aber er wusste ja auch gar nicht so genau, was los ist. Er hat aber gemerkt, dass ich lange fort bin. Das hat ihm dann irgendwie Angst gemacht, weil das halt nicht normal ist, dass eine Mutter nicht daheim ist.
Warst du denn immer zuversichtlich, was deine Erholung anging, oder gab es auch Momente, in denen du dich ernsthaft mit der Möglichkeit auseinandersetzen musstest, den Krebs nicht zu überstehen?
Also vor der OP war ich wie gesagt dermaßen zugedröhnt mit Medikamenten, dass ich nicht viel reagiert habe. Das war alles ziemlich emotionslos, möchte ich mal sagen. Ich bin dann auch relativ schnell – ich glaube 14 Tage – nachdem ich die Diagnose bekommen habe, operiert worden, weil es ja notwendig war. Wenn es später gewesen wäre, dann wäre ich gestorben. Aber ich glaube, ich hab‘ das gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr dran.
Würdest du rückblickend sagen, es war gut, dass du dieses Bewusstsein nie hattest?
Ja, ich denk schon, sonst hätte ich die Panik gekriegt. Ich dachte: Tumor operieren, raus und dann geht’s mir gut. (lacht) Hätte ich gewusst, was für Konsequenzen das alles hat, wäre ich wahrscheinlich anders an die Sache rangegangen. Klar, ich hätte mich trotzdem operieren lassen, aber dann hätte ich definitiv mehr Angst gehabt.
Gab es für dich denn einen besonderen Tiefpunkt während dieser Zeit?
Einen Tiefpunkt? Dass ich mich überhaupt nicht bewegen konnte. Ich war ja halbseitig gelähmt. Ich bin nur im Rollstuhl gesessen. Ich hab‘ nicht duschen können, nicht aufs Klo gehen können. Ich konnte auch nicht reden. Ich habe das Reden erst wieder lernen müssen. Das war total schlimm.
Was hat dir in dieser Situation geholfen, weiterzumachen? Familie? Glaube?
Nee, also Glaube war es wohl nicht. Es war, weil ich immer Fortschritte gesehen habe, denk' ich. Da war ich immer zuversichtlich. Aber das Allerwichtigste war: Ich hab‘ keine Depressionen mehr gehabt. Wenn ich einen Anlass gehabt hätte, Depressionen zu kriegen, dann war das durch die OP. Bei mir war es ja aber so, dass das fünf Jahre vorher schon angefangen hat. Nach der OP hatte ich nie wieder Depressionen und das war auch ganz arg wichtig. Das hat mich irgendwie positiv gestimmt, denk‘ ich.
Was denkst du, woher diese Depressionen kamen?
Das lag wohl daran, dass der Tumor schon fünf Jahre vorher gewachsen ist. Vor der OP war ich ja schon vier Mal stationär, wochenlang. Hab‘ starke Medikamente gekriegt und alles. Irgendwie hat es dann wohl geholfen, aber es ging immer wieder los. Das war so ein Kreislauf und immer wurden die Depressionen stärker. Ich denke schon, dass das mit dem Tumor zusammengehangen hat. Wie gesagt, danach hatte ich nie mehr irgendwas, obwohl ich dann eigentlich erstmal einen Grund gehabt hätte – wo ich nicht mehr reden konnte, wo ich nicht mehr laufen konnte.
Also war die OP auch allgemein ein Wendepunkt in deinem Leben?
Ja, ein ganz riesiger Wendepunkt. Das stimmt mich heute noch positiv, denn es gibt nichts Schlimmeres wie Depressionen. Wenn man in der Klinik ist und sich freut, dass man seine Kinder nicht um sich hat – das ist der Albtraum.
War die Zeit vor der OP dann fast schlimmer als die Krankheit selbst?
Auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass du in deinem alltäglichen Leben immer noch durch die Folgen der Krankheit eingeschränkt bist?
Klar, also das eine Auge ist ja nach wie vor nicht einsatzfähig und ich sehe alles doppelt. Wobei ich aber denke, dass ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich das nicht mehr ständig wahrnehme. Was mir am meisten zu schaffen macht, ist halt, dass ich so viel vergessen habe und auch immer noch so viel vergesse. Sei es jetzt, dass ich mir einen Einkaufszettel machen muss, weil ich nicht fähig bin, mir mehr als drei Sachen zu merken. Das Gedächtnis hat eben arg Schaden genommen. Durch die Tumorentfernung ist ja auch ein Teil vom Gedächtnis entfernt worden. Oder auch, dass ich verbal immer noch eingeschränkt bin. Klar, ich konnte damals überhaupt nicht reden. Ich hab‘ das komplett neu lernen müssen. Das ist natürlich schon ganz toll, wie ich jetzt reden kann, aber ich suche ganz oft nach Wörtern oder Namen. Ich hab‘ überhaupt kein Namensgedächtnis mehr. Das macht mir schon zu schaffen.
Glaubst du, dass dich die Krankheit auch menschlich verändert hat? Siehst du manche Dinge heute anders als damals?
Ja, total. Also das hängt sicher auch mit den Depressionen zusammen, aber manchmal denke ich, ich hab‘ keine Angstgefühle mehr. Ich sehe alles ganz lässig. Also irgendwie ist mein Leben trotzdem leichtfertiger und wesentlich positiver geworden. Das merk‘ ich jetzt ganz stark.
Wenn du heute an den Punkt zurückreisen könntest, an dem es dir am schlechtesten ging, was würdest du dir selbst sagen?
Dass es gut ausgeht. Dass ich zwar eine harte Zeit vor mir habe, aber die Zeit danach besser wird. Dass ich jetzt viel eher leben kann. Damals war alles nur Probleme, Probleme, Probleme. Jetzt ist das Leben so, dass man es auch genießen kann – trotz der Mängel, die ich heute noch habe.
Also hat es sich gelohnt?
Ja. Auf jeden Fall.