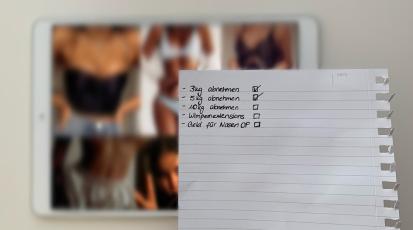„Inklusionssport nach Lehrbuch gibt es nicht. "
Wenn Unterschiede verschwimmen

Lea sitzt verängstigt auf dem Rand des Schwimmbeckens und beobachtet Mathilda, die ihren Kopf für einige Sekunden unter Wasser tunkt, prustend wieder an die Oberfläche kommt und den Mund weit aufreißt, um möglichst viel Luft für den nächsten Tauchgang einzuatmen. Ein Unterschied zwischen den beiden. Lea hat eine Autismus-Spektrum-Störung, Mathilda ist nicht beeinträchtigt. Aufgrund Leas Beeinträchtigung ist ihre Angst noch zu groß und der Mut zu klein, selbst auch einmal unterzutauchen. Das Rauschen des Wassers, die brütende Hitze, Kinderstimmen, die das ganze Hallenbad erfüllen – die Reize wirken wie eine Überflutung für Leas Sinne. Doch je länger sie Mathilda beobachtet, desto hibbeliger wird ihr kleiner Körper. Sie will es auch schaffen. „Darf ich mir mal deine Taucherbrille ausleihen?“, fragt sie mit piepsiger, unsicherer Stimme. „Klar“, entgegnet Mathilda und reicht ihr die Taucherbrille. Lea streift sich die Brille über die Haare, hält sich am Beckenrand fest, holt tief Luft und steckt ihren Kopf das erste Mal für zwei Sekunden unter Wasser.
Autismus bzw. eine Autismus-Spektrum-Störungen wird auch als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung bezeichnet, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken. Dabei wird der Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ (ASS) als Oberbegriff für das gesamte Spektrum autistischer Störungen verwendet, da in der Praxis die Unterscheidung unterschiedlicher Formen zunehmend schwerer wird. Besonderheiten im Umgang, dem Verhalten und der Kommunikation von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind beispielsweise:
- Schwierigkeiten soziale und emotionale Signale richtig zu deuten sowie diese auszusenden. Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen sind selten angemessen.
- Alltägliche Aufgaben sind charakterisiert durch eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, die starr und routiniert ausgeführt werden.
- Betroffene haben große Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Umwelt- und Sinnesreizen, was zu einer Überladung mit Sinneseindrücken führen kann.
Zwischen all den Kindern mit unterschiedlichen Körperformen, Hautfarben und Herkünften, mit oder ohne Beeinträchtigung steht Annette im Wasser – mit einem Strahlen im Gesicht. „Misch die Leute und es profitieren alle davon“, lautet ihr Credo.
„Beine ran ziehen, kreisen, ausstrecken. Los, du schaffst das!“, ruft Annette über das Wasser hinweg, während sie langsam die zögernde Hand eines Jungen loslässt. Als er endlich losschwimmt, klatscht sie in die Hände, als würde er gerade Gold bei Olympia gewinnen. „Klasse! Bravo! Siehst du, du kannst das. Weiter! Weiter!“, feuert sie ihn an und weicht ihm keinen Meter von der Seite, bis die gesamte Bahn hinter ihm liegt und er sich erschöpft an den Beckenrand klammert, um seinen Kopf darauf abzulegen. Annette tätschelt ihm belohnend den Kopf, dann streift sie durch das Wasser zum nächsten Kind. „Weißt du, warum es nicht klappt?“ Das Mädchen schüttelt schüchtern den Kopf. Behutsam legt Annette die kleinen Handflächen des Mädchens in ihre. „Deine Hände sind außer Kontrolle, die Finger müssen schön eng zusammenhalten.“ Sie überlegt ein paar Sekunden. Dann schnappt sie sich einen blauen Verband vom Beckenrand und bindet die zarten Finger des Mädchens zusammen. „Merk dir eins für dein Leben: Das geht nicht, gibt’s nicht, sondern nur Lösungen“, lacht sie. Und während das Mädchen plötzlich einwandfrei ihre Bahnen zieht, kommt ihr Vater nicht mehr aus dem Staunen heraus: „Annette, ich liebe deine Spontanität und deine Kreativität.“

Annettes Frisur ist schon immer dieselbe, lange Haare, braun mit ein paar hellen Strähnen. Der Pony ist kurz und wild geschnitten. Ihre Art zu reden, nie in einem Drill Ton. „Meine größte Schwäche?“, fragt sie belustigt während sie die Schwimmflügel für den nächsten Kurs aufbläst. „Ich kann nicht Nein sagen. Auch wenn ich noch nie mit einer Art der Behinderung zu tun hatte oder erst recht nicht, wenn Familien nicht für einen Kurs bezahlen können. Dann lade ich sie trotzdem ein. Wir finden schon eine Lösung. Kein Kind darf nicht Schwimmen lernen oder turnen, nur des Geldes wegen.“
Fragt man Annette nach ihren eigenen Problemen oder schweren Zeiten, wird keine Antwort kommen. Auch wenn bestimmte Kapitel ihres Lebens als alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs davon geprägt waren. „Ich kann nicht zu meinen Handicap Kindern sagen: ‚Alles halb so wild‘, und ich setzte mich dann hin und jammere. Niemanden bringt Jammern weiter.“
2001: Das Jahr der Veränderung
Wenn Annette an ihre Kindheit denkt, dann taucht dort keine einzige Erinnerung an ein beeinträchtigtes Kind auf. „Die wurden früher glaube ich einfach zu Hause versteckt, weil sowieso niemand mit ihnen spielen wollte", vermutet sie. Erst, als Annette selbst als Mutter den Wunsch ihrer Tochter erfüllt, zum Kinderturnen zu gehen, wird ihr eines bewusst: Hier gibt es nur Kinder ohne Beeinträchtigung, die sich in einer Reihe aufstellen, einmal über einen Kasten springen und sich wieder einreihen und warten. „Das funktioniert so nicht. Wir Menschen sind alle unterschiedlich, jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Ob beeinträchtigt oder nicht.“
Annette beginnt ab diesem Tag sämtliche Trainerscheine zu absolvieren, um Sport für alle, egal ob beeinträchtigt oder nicht und egal welche Art oder Schwere der Beeinträchtigung, anzubieten. Ihre Tochter verbringt die Wochenenden mit ihr in der Turnhalle. „Ich muss so gut sein, dass wirklich jeder bei mir Sport treiben kann. Das ist meine Prämisse. Und ich bin niemals diejenige, die sich hinstellt und sagt: ‚Du bist nicht willkommen.‘ Das ist nicht meine Mentalität. Und wird es niemals sein. Man muss einfach mit jedem Menschen ordentlich umgehen."
Aus zwei Stunden Kinderturnen am Dienstag sind heute 30 Stunden ehrenamtliche, inklusive Sportkurse für Kinder geworden, die sie neben ihrer Arbeit als Erzieherin wöchentlich gibt. Darunter Schwimmkurse, Kinderturnen, Qi Gong, Neurorehakurse, Laufgruppen und vieles mehr. Die Schwierigkeit dabei: „Jedes Kind muss genau auf dem Stand abgeholt werden, wo es gerade ist“, erklärt Annette, während sie zwei verdutzt dreinschauende Babys auf einer Matte durch das Wasser schiebt, die gerade das Sitzen lernen sollen.
Während manche Kinder das vierte Jahr in Folge hier in der Schwimmhalle des Blindeninstituts in Würzburg versuchen das Seepferdchen zu schaffen, brauchen manche dafür nur einen Kurs. Somit ist jedes Kind in Annettes Kursen auf einem anderen Leistungsstand. Für jede Art der Beeinträchtigung muss sie sich einen neuen Ansatz ausdenken, um ihnen das Schwimmen beizubringen. „Eigentlich ist es kein Hexenwerk. Man muss einfach kreativ sein. Du kannst jeden Sport und jedes Spiel etwas umändern“, sagt sie stirnrunzelnd und zuckt mit den Achseln, als wären die Worte, die sie gerade ausgesprochen hat, eine Fremdsprache, die sie nicht versteht.
Aber das sei laut Annette nicht gewollt von der Gesellschaft. Kinderärzte würden oftmals keine Rezepte für Rehasport ausstellen, mit der Begründung: „Das bringt sowieso nichts, ihr Kind kann das nicht.“ Annette zieht einen leicht verknitterten Zettel aus einer Mappe, das Rezept 56, ein nasser Tropfen aus einer ihrer Haarsträhnen perlt darauf ab und verschmiert leicht die Tinte zweier Buchstaben. „Ich fülle das Rehasport Rezept mittlerweile einfach selber für die Familien aus, weil viele Ärzte das Rezept nicht einmal kennen." Der Arzt müsse dann nur noch unterschreiben. Sie verdreht die Augen. Noch schwieriger sei es geworden, freiwillige Helfer zu finden, die ehrenamtlich die immer mehr werdenden Kinder in den Kursen und Annette unterstützen wollen. Vereine, die selbst kein Interesse am Engagement für beeinträchtigte Menschen hätten, würden diese lieber an andere Kurse wie Annettes abschieben. Rund sieben Prozent der über 87.000 Sportvereine in Deutschland bieten Sportmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten an – bei insgesamt 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung, von denen rund 8 Millionen schwerbehindert sind. „Viele Menschen haben einfach keinen Bock. Die verstehen nicht, warum manche von uns eben eine Extrawurst brauchen. Ich finde es einfach schade, dass es so wenige gibt, die sich diese Arbeit auch zutrauen. Ich bin die einzige in Bayern mit einem Neuro-Reha-Schein", bedauert Annette. Dabei sind in Deutschland rund 60 Prozent der Bevölkerung von einer neurologischen Erkrankung betroffen. „So ein bisschen Herzprobleme und Orthopädie – alles kein Problem. Klar kann bei neurologischen Fällen unheimlich viel passieren. Dafür habe ich ja immer die erfahrenen Eltern in jedem Kurs und bei jedem Schritt dabei, die ihr Kind in und auswendig kennen. Und je länger man sich mit jeder neuen Krankheit beschäftigt, desto offener wird man auch.“
Liegt eine neurologische Erkrankung, das heißt vor allem Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks oder des peripheren Nervensystems vor, kann eine neurologische Rehabilitation angeordnet werden. Um dabei als Übungsleiter mit neurologischen Fällen arbeiten zu dürfen, bedarf es einer Lizenz, dem Neuro-Reha-Schein. Dabei werden in Grundlagen- (Block 10) und Aufbauseminaren (Block 60) spezifische Inhalte bezogen auf neurologische Behinderungs- und Krankheitsformen vermittelt, wie:
- Didaktik/Methodik
- Biologische und medizinische Grundlagen
- Sportpraktische Beispiele
- Trainings- und Bewegungslehre
- Psychologie und Soziologie
- Sportorganisation und -verwaltung
- Ernährung
Die Dauer ist je nach Lehrgang und Anbieter unterschiedlich, z.B. in Baden-Württemberg 14 Tage. Die Ausstellung der Rehasport-Lizenzen obliegt den Landesverbänden des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) e.V. sowie dem Bundesverband Rehabilitationssport RehaSport Deutschland e.V. (RSD).
Das Lernen von Inklusion als Lebensgrundstein
Offenheit und Toleranz. Die Stichworte, die Annette den Kindern in ihren Kursen von klein auf mit auf ihren Lebensweg geben möchte. „Nicht beeinträchtigte Menschen müssen lernen, dass Menschen mit einer Behinderung nicht schlimm sind!“. Und das am besten so früh wie möglich.
„Kinder sind neugierig, die haben keine Hemmungen oder Vorurteile“, erklärt Annette. Sie hätten eine weitaus höhere Diversitätstoleranz, würden jedoch nach und nach von der Gesellschaft sozialisiert werden, wodurch Stereotype und Vorurteile entstehen würden. „Dann gibt es auf einmal ein „normal“ und ein „unnormal". Berührungsängste und Ausgrenzung sind vorprogrammiert“, schnaubt Annette, sichtlich genervt von dieser Entwicklung.
Lässt man den Blick über das große, 35 Grad heiße Schwimmbecken schweifen, in dem beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder mit ihren Eltern planschen, wird Annettes Credo deutlich: die Vielfalt muss miteinander gelebt und nicht versteckt werden. Denn davon profitieren laut Annette alle. Die beeinträchtigten Kinder, die nicht beeinträchtigen Kinder als auch deren Eltern.
„Viele Eltern, die zu mir gekommen sind, haben zu Beginn verheimlicht, dass ihr Kind eine Behinderung hat. Einfach weil sie bei jedem anderen Verein sofort ausgeschlossen wurden“, erzählt Annette frustriert, während sie sich am Beckenrand mit einer Hand um ihr angewinkeltes Bein klammert und sich mit der anderen wild durch die Haare fährt. Die Eltern könnten sich hier austauschen, sich gegenseitig bei Problemen im Alltag helfen und daran erinnert werden: „Ich bin nicht alleine.“ Die Mutter der siebenjährigen Leonie, die an Epilepsie erkrankt ist, beobachtet ihre Tochter mit einem Lächeln auf den Lippen, während sie und ihr Vater im Wasser das Brustschwimmen üben. „Ich habe endlich aufgehört, mich mit anderen Eltern zu vergleichen. Wenn ich jetzt sehe, wie Leonie sich über Wasser halten kann, obwohl bis vor ein paar Jahren nicht einmal klar war, ob sie jemals laufen wird, bin ich nur noch dankbar über jeden noch so kleinen Fortschritt“, erzählt sie stolz.
Für die Kinder bedeutet der gemeinsame Sport Lernen am Modell. „Klar sind alle unterschiedlich oder eben gar nicht eingeschränkt. Aber es kann jeder vom anderen kopieren“, so Annette. Dass Kinder sich, egal ob Gutes oder Schlechtes, voneinander abschauen, sei ein wichtiger Bestandteil aus pädagogischer Sicht, um soziale Kompetenzen zu erlernen, wie Empathie, Hilfsbereitschaft oder Teamfähigkeit.
„Und jeder Arzt, jede Ärztin oder jede Person, die sagt, dass Sport oder gerade Wasser den beeinträchtigten Kindern nichts bringt, der unterschätzt das Element Wasser. Wenn ich an meinen muskelkranken Ampo denke, der nach seinen Übungen im Wasser sogar schreiben kann, was er sonst nie könnte. Er kann vielleicht nicht schwimmen aber dir von jedem Land der Welt die Hauptstadt aufsagen. Xaver, mit gelähmten Beinen und offenem Rücken, der sein Bronzeschwimmer-Abzeichen geschafft hat und heute sogar bei Wettkämpfen im Handbike mitfährt. Alles ist möglich.“
Harte Arbeit, große Belohnung
Seit acht Stunden steht Annette im Wasser. Ungefähr 55 Kinder hat sie heute auf dem Weg zu ihrem Seepferdchen unterstützt. Ihre Hände und Füße gleichen Schwimmhäuten. Wie zugeschnürt verweigert ihre Kehle der Stimme jeden weiteren Ton. Einmal reichte ihr Mann Jens eine warme Thermoskanne mit Tee ins Becken, die sie in großen Zügen austrank. Wenn man Annette jetzt ansieht, in ihre vom Chlorwasser geröteten Augen, wie sie immer noch über das ganze Gesicht lacht und die Kinder freudig in die Sommerferien verabschiedet, wie ihr nun vor Kälte zitternder Körper immer noch Energie und Tatendrang ausstrahlt, könnte man meinen, dass alles, was sie in den letzten 23 Jahren auf die Beine gestellt hat, ein Kinderspiel war. Doch eigentlich ist sie eine Frau, die hunderten von Kindern, beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt, die Hoffnung und die Willensstärke geschenkt hat, die Schwere des Satzes „Du kannst das nicht" in der letzten Schublade eines Kindeskopfes zu vergraben. Und diese nie wieder zu öffnen.