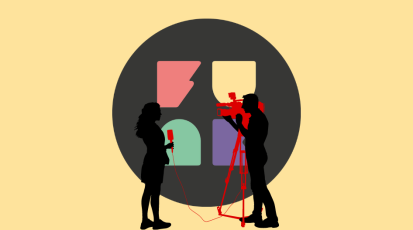„Mit so einer Reichweite ist es die größte Verantwortung, es nach eigenen Möglichkeiten sinnvoll auszufüllen.“
Politik? Hab' ich mal in 'nem Reel gesehen…

Politische Kommunikation findet heute dort statt, wo junge Menschen unterwegs sind: in den sozialen Medien. Immer häufiger sind es nicht mehr Journalist*innen, die den Ton angeben, sondern Einzelpersonen, sogenannte politische Influencer*innen. „Tara Louise Wittwer (@wastarasagt), Louisa Dellert (@louisadellert) oder Nina Poppel (@nini_erklaert_politik) sind legitime Akteure und eine echte Bereicherung“, erklärt Paula Nitschke, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg. Einige berichten über politisch relevante Themen wie Feminismus, Klimaschutz und Gleichberechtigung, andere vermitteln, wie die Wahlen, Parteien und Politik im Allgemeinen funktionieren.
Zeitung? Was ist das?
Politische Influencer*innen treten neben die Berichterstattung professioneller Medien und gestalten die Struktur politischer Kommunikation um. Durch direktes Feedback wie Teilen, Liken und Kommentieren wird die klassische „One-to-Many“-Kommunikation, von Journalist*innen zu Rezipient*innen, in eine dynamische „Many-to-Many“-Kommunikation verwandelt. Das bedeutet, dass alle gleichzeitig miteinander agieren können. Politische Content Creator schaffen damit neue Räume der Kommunikation, in denen sich massenmediale und persönliche Kommunikation zunehmend vermischen.
Die Funktion der journalistischen Kontrolle über Inhalte, auch Gatekeeper genannt, entfällt dabei. Das bestätigt auch Nitschke: „Vor den digitalen Medien befanden wir uns im Gatekeeper-Paradigma, in dem klassischer Journalismus bestimmen konnte, wer Zugang zur Öffentlichkeit hat und welche Stimmen gehört werden. Mit den sozialen Medien hat sich diese Anbieterseite jedoch enorm vervielfältigt.“
Politische Social-Media-Influencer*innen sind Nutzer*innen, die über Social Media bekannt wurden. Sie verbreiten als selbst-inszenierte Personenmarken regelmäßig selbst produzierte politische Inhalte und erreichen damit ein breites Publikum, das sie potenziell beeinflussen können.
Quelle: Halina Bause Politische Social-Media-Influencer als Meinungsführer?
Freundschaft durch den Bildschirm
Theoretisch können sich also alle, die politische Inhalte auf Social Media teilen, als Politik-Influencer*innen bezeichnen. Entscheidend ist jedoch nicht nur das Posten von Inhalten. Wer wirklich Einfluss nehmen möchte, muss kommunikationsfreudig, selbstbewusst und glaubwürdig sein. Ein niedrigschwelliger Einstieg, die einfache Sprache und auch ein gewisser Entertainment-Faktor würden dazu führen, dass sich junge Menschen angesprochen fühlen, so als würde einem eine beste Freundin oder ein bester Freund was erklären, sagt Jana Hielscher, Dozentin für Social Media und Bildredaktion an der TH Köln. Dieses Phänomen nennt man auch parasoziale Beziehung. Man hat das Gefühl miteinander befreundet zu sein und sie aus dem Netz zu kennen. Politische Influencer*innen schaffen so Vertrauen und agieren auf Augenhöhe mit ihrem Publikum.
Junge Menschen nutzen Social Media gezielt zur politischen Informationsbeschaffung. Damit bewegen sich politische Content Creator in einem Umfeld, in dem sie die Meinungsbildung junger Menschen potenziell stark beeinflussen können. Dies unterstreicht neben den Ergebnissen der Landesanstalt für Medien NRW auch die Shell-Studie 2024. Rund 2500 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren wurden unter anderem zu ihrer politischen Informationsbeschaffung befragt. Das Ergebnis zeigt, dass 45 Prozent der Befragten Online-Medien als politische Informationsquelle nutzen. 2019 waren es zum Vergleich noch lediglich 30 Prozent. Neben klassischen Online-Nachrichtenseiten zählen dazu auch Inhalte politischer Influencer*innen, die damit zunehmend die Rolle digitaler Meinungsführenden übernehmen.
Während die Kommunikationswissenschaft früher davon ausging, dass politische Einstellungen vor allem durch Gespräche im nahen Umfeld geprägt werden, übernehmen heute Creator*innen diese Funktion, wie Amelie Duckwitz, Professorin an der TH Köln, in ihrer Publikation "Influencer als digitale Meinungsführer" feststellt.
Reichweite verpflichtet, oder?
Rezo (@rezo) kann als Politik-Influencer bezeichnet werden. In die politische Öffentlichkeit rückte er 2019 mit seinem YouTube-Video „Die Zerstörung der CDU“, das bis heute über 20 Millionen Mal aufgerufen wurde. Seitdem spricht er regelmäßig über politische Themen, die er auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Allein auf Instagram hat er derzeit 1,4 Millionen Abonnent*innen. In einem Interview sagt er: „Mit so einer Reichweite ist es die größte Verantwortung, es nach eigenen Möglichkeiten sinnvoll auszufüllen.“
Rezo betont die Verpflichtung, die mit seiner Reichweite einhergeht. Inwiefern sich weitere politische Influencer*innen ihrer Verantwortung bewusst sind, erklärt Nitschke, die aktuell ein Projekt zu politischen Online-Influencer*innen leitet. Sie betont, dass hier die Spreu vom Weizen getrennt werden müsse: „Manche sind sehr reflektiert. Andere machen sich keine Gedanken und sind recht unbedarft. Zum Teil sehr junge Leute, die oft mit fünfzehn, sechzehn oder siebzehn Jahren anfangen und sich dann entwickeln.“
Meinung per Swipe
Mit jedem neuen Kanal, der mehr Menschen erreicht, steigt auch die potenzielle Gefahr von Desinformation, ob beabsichtigt oder nicht. Genau hier zeigt sich der Unterschied zur journalistischen Berichterstattung. Journalist*innen unterliegen Regeln wie der Faktenprüfung und dem Offenlegen von Quellen. In den sozialen Medien hingegen vermischen sich persönliche Meinung und Information, beschreibt Nitschke im Gespräch. Diese Meinungen können den Anschein erwecken, sie seien neutrale und faktenbasierte Informationen.
Viktoria Rösch, Soziologin und Expertin für rechtsextreme Influencer*innen auf Social Media, erklärt: „Es ist wichtig, sich bei jedem Video zu fragen, ist das wirklich echt oder nur dazu da, etwas anzuheizen.“ So können bestimmte Politische Influencer*innen es auch gezielt ausnutzen, ihre persönliche Meinung als politischen Content zu präsentieren. Sie vertreten dabei verschiedenste politische Richtungen und Weltanschauungen. Laut der Tagebuchstudie der Landesanstalt für Medien NRW kann diese Form der politischen Kommunikation auch Risiken für die Konsumierenden bergen. 50 Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren stuften soziale Medien, direkt nach den Angeboten der Öffentlich-Rechtlichen, als eine der vertrauenswürdigsten und informativsten Quellen politischer Berichterstattung ein.
„Es ist wichtig, sich bei jedem Video zu fragen, ist das wirklich echt oder nur dazu da, etwas anzuheizen.“
Und jetzt?
Die Expertinnen Nitschke, Hielscher und Rösch sind sich einig: Um die positiven Aspekte der politischen Kommunikation auf Social Media zu stärken, muss die Medienkompetenz der Nutzer*innen gefördert werden. Sie sollten lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen: Wer spricht, mit welcher Absicht und auf welcher Grundlage. Für die Zukunft wird Politik-Influencer*innen jedoch das Potenzial zugesprochen, einen positiven Beitrag zur politischen Bildung zu leisten.
Durch ihre neue Art der Kommunikation sowie die niedrigschwellige und emotional zugängliche Darstellung politischer Inhalte können sie auch Menschen erreichen, die bisher kaum Berührung mit Politik hatten, so das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation. Die Landesanstalt für Medien NRW betont in einer Studie, dass Sozialen Medien nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum Journalismus verstanden werden sollten. Wenn politische Influencer*innen ihre Inhalte transparent, nachvollziehbar und reflektiert aufbereiten, können sie demnach ein wichtiger Bestandteil zeitgemäßer politischer Bildung sein.