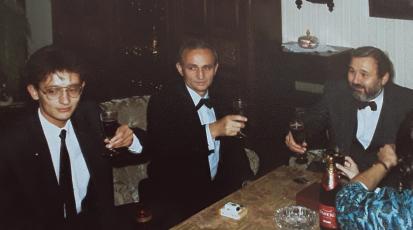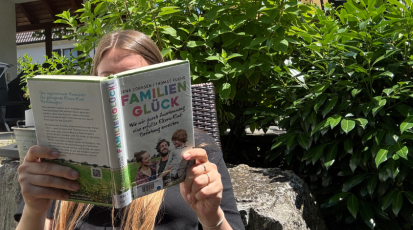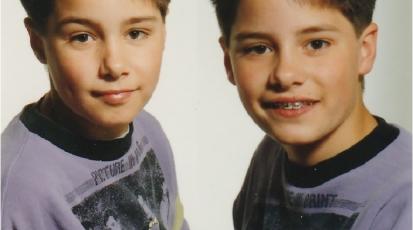"In den 80er Jahren haben wir Dinge auswendig gelernt, weil der Lehrer das wollte, ohne klaren Bezug. Heute würden selbst Zehnjährige fragen: warum?"
Früher Züchtigung, heute Zuwendung: Wie sich die Kindheit verändert hat

Hinweis
Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema "Erziehung".
Außerdem zum Dossier gehören folgen de Beiträge:
Erziehung ist kein festes Konzept. Es gibt keine perfekte Anleitung. Es gibt keine perfekte Formel. Meistens ist sie eher ein Spiegel ihrer Zeit und Gesellschaft. Doch wie hat sich die Erziehung im Laufe der Jahrzehnte verändert? Welche Methoden lassen sich ausmachen? Ein Blick auf die Erziehungsziele und -methoden der letzten Jahrzehnte verrät vielleicht mehr, als man vermuten mag.
Vom Gehorchen zum Verstehen
Früher galt: Kinder sollen gehorchen, sich unterordnen. Autorität, Disziplin und Gehorsam standen an erster Stelle. So meint auch Rainer Fanta, Lehrer am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg: „Die Eltern hatten das Sagen, die Kinder mussten mehr oder weniger folgen“. Mit dem gesellschaftlichen Wandel, vor allem durch die 68er-Bewegung wurde dieser absolut-autoritäre Erziehungsstil stark hinterfragt. Mit den Kriegsgenerationen, welche noch mit autoritären Strukturen aufgewachsen waren, wurde sehr bewusst gebrochen.
Erziehungsmethode: Einseitige Bestrafung oder kooperative Erziehung
Um die Erziehungsziele von Autorität, Disziplin und Gehorsam zu wahren, war die sogenannte: „schwarze Pädagogik“ oftmals Alltag. Körperliche Strafen, autoritäre Erziehende und Lehrende und straffe Reglements bestimmten nicht nur Elternhaus, sondern auch Schulalltag. Die Erziehung wurde durch Angst und Kontrolle geprägt. So vergleicht Fanta seine Kindheit mit dem Schulalltag heutzutage: „In den 80er Jahren haben wir Dinge auswendig gelernt, weil der Lehrer das wollte, ohne klaren Bezug. Heute würden selbst Zehnjährige fragen: warum?“ Diese Haltung, als Heranwachsender zu hinterfragen, zeigt den heutigen Trend: kooperative Erziehung. Es geht um Kommunikation und Mitbestimmung. Lehrer übernehmen im Kontext des Schulalltags eine zunehmend reflektierende Rolle. Statt sinnloser Bestrafung, eher die Kommunikation suchend. Strafen, wenn dann sinnvoll gestaltet. Die pädagogischen Entscheidungen der Lehrkräfte den Schülern gegenüber sind transparenter. Dies sorgt auch für mehr Verständnis und fördert ein Miteinander statt eines Gegeneinanders.
Was Kinder brauchen
Noch in der Nachkriegszeit galten Gefühle als Schwäche. Besonders Jungen wurde beigebracht, „hart“ zu sein. Schmerz, Angst oder Unsicherheit fanden keinen Platz. Heute weiß man: Kinder brauchen nicht nur Grenzen, sondern auch Zuwendung, emotionale Sicherheit und Spiegelung ihrer Gefühle.
Moderne Erziehung fördert gezielt die emotionale Kompetenz: die Fähigkeit, eigene Gefühle zu erkennen, zu benennen und konstruktiv zu regulieren. Das stärkt nicht nur das soziale Miteinander, sondern auch die psychische Gesundheit und den Lernerfolg. Was sie wirklich brauchen: verlässliche Beziehungen, echte Werte und Raum zur Entfaltung.
Digitale Kindheit
Ein sehr zentraler Wandel ist die digitale Revolution, sie macht sich nicht nur im Lebensalltag aller Menschen breit, sondern vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Mittlerweile nutzen 93 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren das Smartphone täglich. Da viele Eltern noch in Zeiten von Papier, Stift und Hefter aufgewachsen sind und Kinder heute mit Smartphone, Instagram und ChatGPT aufwachsen, stellt dies die Erziehung der Kinder vor Herausforderungen.
In Schulen wird der Fokus auf Medienkompetenz statt Fachkompetenz gesetzt. Da die Kinder und Jugendlichen oft besser Bescheid wissen als ihre eigenen Eltern oder Lehrer. Es geht nun viel mehr darum, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie sie ihre digitalen Kompetenzen einsetzen können. Wie recherchiert man richtig mit KI? Wie nutzt man Social Media? Wie kann man digitale Elemente in den Schulalltag einbringen? Der Erziehungsauftrag liegt also hierbei auch und vor allem bei den Bildungseinrichtungen und Schulen.
Was bleibt wichtig?
Trotz aller Veränderungen, die über die Zeit stattgefunden haben: Es gibt Werte, die bleiben und die zeitlos sind. Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Empathie und Pünktlichkeit. Fanta mahnt, diese Werte seien nicht altmodisch, sondern bildeten die Grundlage für soziale Stabilität. Gleichzeitig plädiert er für eine Rückbesinnung auf klare Verantwortlichkeiten: „Auch wenn Erziehung heute kooperativ ist, muss klar sein: Die Eltern sind die Chefs und in der Schule sind es die Lehrkräfte.“ Eine völlige Auflösung von Rollen führe bei der Erziehung von Kindern nicht zu Freiheiten, sondern führe zu Überforderung und Orientierungslosigkeit. Erziehung ist kein Entweder-oder. Es braucht eine Balance zwischen Freiheit und Führung, Nähe und Struktur, sowie Technik und Menschlichkeit. Um dies umzusetzen, sind nun Eltern, Erzieher, Lehrkräfte und Einrichtungen gefragt.