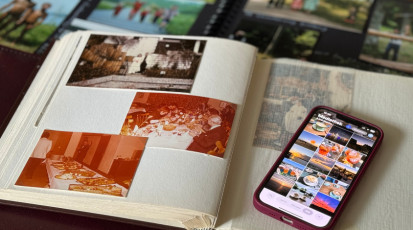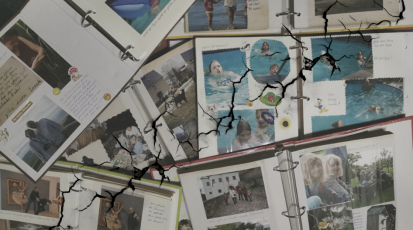Ein Hof voller Kompromisse

Draußen hört man es wütend gackern. Neben einem Traktor kämpfen gerade zwei Hühner um den gleichen Grashalm. Im Futterraum des Koberhofs sind die Silos fast leer. Bald wird neu gemischt. Was in welcher Menge dazu kommt, richtet sich nach den Bedürfnissen der Hühner. Ulrich Kober steht im neongrünen Polo zwischen den Anlagen. Auf der Brust: das hofeigene Logo. Er erklärt ausführlich, welche Bestandteile wofür wichtig sind. Teile des Futters stammen von den eigenen Feldern. Manche Zutaten muss Kober dazu kaufen, wie zum Beispiel Muschelschalen – wichtig für die Calciumversorgung. „Die kommen natürlich nicht von hier“, schmunzelt er und zeigt nach draußen. Dort ist weit und breit kein Strand in Sicht, dafür aber jede Menge Felder und dahinter die dunklen Baumwipfel des Schwarzwalds. Über verschiedenfarbige Schläuche wird die Körner- und Schalenmischung später automatisch in die Ställe transportiert. Denn nur ein Teil der Hühner pickt hier auf der Wiese im Freien. Die meisten leben im Stall.
Als die Schweine gingen
Ulrich Kober hat den Hof nicht einfach übernommen. Er hat ihn Stück für Stück zu dem gemacht, was er heute ist. Seit fast 500 Jahren ist der Koberhof in Familienbesitz, doch als er ihn 1997 mit 32 Jahren übernahm, war von einem modernen Betrieb nicht viel zu sehen. Der Zustand war schwierig. Vieles war veraltet und renovierungsbedürftig. Vor allem aber passte die Tierhaltung nicht zu seinen Vorstellungen. „Ich liebe Schweine“, sagt Kober heute, aber mitansehen, wie sie in einem dunklen Stall auf Vollspaltenboden gehalten wurden, das wollte er nicht mehr. Also entschied er nach einigen Umbaumaßnahmen, die Schweine aufzugeben und sich auf Geflügel zu konzentrieren. Denn neben den Schweinen gab es auf dem Hof damals auch noch eine Legebatterie. Enge Käfige, wenig Licht, kein Platz zum Scharren oder Flattern.
Legebatterien sind in Deutschland erst seit 2010 verboten. Erlaubt sind heute für Legehennen folgende Haltungsformen mit diesen Mindestanforderungen:
Kleingruppenhaltung (EU-Eier-Stempel 3)
800 cm² Platz pro Henne. 4–5 Hennen leben in einem Käfig. Drahtgitterboden und kein Tageslicht. Stangen und ein Legenest pro Käfig.
Diese Haltungsform ist ab Ende 2025 verboten.
Bodenhaltung (EU-Eier-Stempel 2)
Maximal 9 Hennen pro m². Der Stall muss eine feste Bodenfläche haben und zu mindestens einem Drittel eingestreut sein. Tageslicht ist nicht vorgeschrieben, aber die Beleuchtung muss dem Tageslicht angepasst sein. Es müssen Stangen und genügend Legenester vorhanden sein.
Die mit Abstand häufigste Haltungsform in Deutschland.
Freilandhaltung (EU-Eier-Stempel 1)
Tagsüber Zugang zu einer mindestens 4 m² großen Auslauffläche pro Henne mit Unterschlupfmöglichkeiten. Ansonsten entsprechen die Anforderungen für das Stallinnere der Bodenhaltung.
Biohaltung (EU-Eier-Stempel 0)
Die Bedingung für den Auslauf entsprechen der Freilandhaltung. 6 Hennen pro m² im Stall. Das Futter wird zu 100 Prozent ökologisch erzeugt.
Kober entschied sich schon Anfang der 2000er gegen die Legebatterie und für Bodenhaltung. Nicht, weil das System ideal ist, sondern weil es für ihn umsetzbar war. Der Anfang war hart. Plötzlich wurde Hygiene ein großes Thema. Wo sich die Tiere frei bewegen, können sich Krankheiten schneller verbreiten. Eine echte Herausforderung. Einfach Antibiotika einsetzen wollte Kober nicht. Stattdessen fand er einen Kompromiss: Die Hühner werden vorbeugend geimpft, per Sprühnebel über die Schleimhäute. Das funktioniere seit 20 Jahren gut. Ergänzt wird das durch ein simples, aber effektives Hygienesystem. Jeder Stall hat eine eigene Farbe mit passender Ausrüstung: Schaufel, Gummistiefel, Overall und eine eigene Waschmaschine. In den Vorräumen sieht alles aus, als wäre es in den gleichen Farbeimer gefallen. „Nichts, was in einem Stall war, darf in den nächsten und so behalten wir den Überblick“, erklärt er.
Während er über den Hof läuft, zwischen Stall und Maschinenhalle, erzählt Kober, dass der Weg nicht immer einfach war. Das Wohnhaus brannte ab, die Maisernte fiel einem Schädlingsbefall zum Opfer, das Geld war knapp. Er berichtet sachlich, fast nebenbei, aber man spürt, was es gekostet hat. Er zeichnet mit der Hand eine Zickzackbewegung in die Luft. So sei das eben gewesen, kein gerader Weg, aber einer mit Ziel. Neue Stallungen kamen dazu, Abläufe wurden optimiert, Mitarbeiter eingestellt. Heute arbeiten rund 20 Menschen auf dem Hof, drei davon festangestellt. Das Hauptgeschäft sind die Hühner: Bis zu 8.000 leben hier, in zwei Bodenhaltungsställen, einem Hähnchenstall und einem mobilen Freilandstall. Dazu kommen einige Puten, Gänse und Enten auf umliegenden Wiesen. Wöchentlich verlassen 40.000 bis 50.000 Eier den Hof, in Richtung Gastronomie und Hotels. In Supermärkte will Kober nicht. Zu große Mengen, zu viel Bürokratie. „Wir wollen regional bleiben.“

Mit Prinzipien und Pragmatismus
Regionalität ist nicht das Einzige, das Ulrich Kober wichtig ist. Tierwohl ist für ihn kein Modewort, sondern fester Bestandteil seines Hofkonzepts. Seine Ställe sind nicht voll besetzt, das gibt den Tieren mehr Platz. Für seine Hennen in Bodenhaltung hat er zusätzlich einen Wintergarten angebaut, damit sie Tageslicht haben, obwohl das gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Auch bei Abläufen und Futterzusammensetzung hat er über die Jahre vieles angepasst. Wenn man ihn fragt, was Tierwohl für ihn bedeutet, zuckt er aber erst nur mit den Schultern. Dann sagt er: „Also, so seltsam sich das anhört, ich kann kein Tier leiden sehen.“ Seltsam klingt das eigentlich nicht, aber vielleicht aus der Sicht eines Landwirts, der von dem Ertrag der Tiere auch leben muss. Auf der einen Seite das Tier, auf der anderen die Zahlen und dazwischen sein Alltag. „Gesunde, zufriedene Hühner sind aber auch produktiver. Sie legen besser und ihr Fleisch ist zarter“, schiebt Kober noch hinterher, während er bei den Hähnchen steht, die bald schon groß genug sind, um geschlachtet zu werden.
Auch beim Schlachten endet der Tierwohlanspruch nicht. „Die Tiere verdienen es, dass man sie ordentlich behandelt.“ Hier bedeutet das: kurze Wege, bekannte Gesichter, professionelle Abläufe. Der Weg vom Stall zum Schlachtraum sind 50 Meter. Die Tiere werden von denselben Menschen geschlachtet, die sie aufgezogen haben. Kober hat dafür eine Ausbildung zum schnellen Töten gemacht, damit die Hähnchen möglichst wenig Stress und keine Schmerzen erleben. Einmal in der Woche ist Schlachttag. 50 bis 70 Tiere. „Sterben ist nie schön“, sagt er. „Es kommt drauf an, wie das Leben war.“

Leben für die Hühner in Kobers Mobilstall heißt: morgens mit der Sonne raus auf ein umzäuntes Stück Wiese, abends zurück auf die Stange, bevor der Fuchs kommt. „Naja, Wiese ist ja nicht mehr viel da“, sagt Kober lachend und blickt auf den kahl gepickten Auslauf. Genau deshalb hat er 2020 den Mobilstall angeschafft. Alle paar Wochen wird er auf ein neues Stück Wiese gezogen, damit sich der Boden erholen kann und die Hühner neues Grün haben. Der Stall selbst sieht aus wie ein Container auf Rädern. Innen sind Stangen, Futter, Wasser, Stroh und Legenester. Draußen ist noch ein Wintergarten angebaut, für schlechtes Wetter oder schüchterne Hühner. „Einige waren wahrscheinlich noch nie draußen“, sagt Kober und klingt weder resigniert noch überrascht. „Manche Hühner sind einfach so. Die anderen freuen sich aber richtig, wenn’s rausgeht und neue Wiese da ist“, erzählt er lächelnd. „Erst schauen sie kurz und denken 'was ist denn jetzt los' und dann geht’s los mit dem Gepicke.“

Wunsch und Wirklichkeit im Eierkarton
Die meisten Eier vom Koberhof gehen an die Gastronomie – und dort ist Freilandhaltung nicht immer gefragt. Der Großteil seiner Hühner lebt deshalb in Bodenhaltung. Für Ulrich Kober geht es dabei nicht um ein „entweder oder“, sondern darum, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. „Es ist wichtig, bei den Gastronomen Alternativen an Eiern anzubieten, damit sie selbst entscheiden können, ob sie Freiland- oder Bodenhaltungseier wollen.“ Eine wirtschaftliche Entscheidung, die den Hof trägt.
Die Haltungsform ist nicht der einzige Kundenwunsch, der hier zählt. Auch im Sortierraum ist Flexibilität gefragt. Zwei Frauen stehen zwischen Förderbändern, das Radio läuft leise. Sie durchleuchten, stempeln und sortieren nach Größe und Schalenfarbe. Weiße Eier in die einen Kartons, braune in die anderen. „Manche Kunden wollen’s eben so“, sagt Kober. Der Stempel verrät Herkunft und Haltung. Die Farbe – nichts. Dass braune Eier besser seien als weiße, hält sich als Irrglaube hartnäckig. Dabei hängt die Färbung einfach von der Rasse ab und von der Farbe der Ohrscheiben der Hühner. Geschmack, Qualität, Nährwert? Gleich. Aber verkauft wird hier, was gewünscht ist.

Ein Biosiegel kommt für Kober deshalb auch nicht in Frage. Da gebe es bei ihm einfach keine Nachfrage und außerdem sei es sehr aufwendig. Die Kontrollen, die Auflagen, die Bürokratie: All das fresse Zeit, Geld und Nerven. Lieber setzt er auf das, was für ihn näher liegt – im wörtlichen Sinne. Alle Abnehmer sind im Umkreis von 40 Kilometern. Wer will, kann vorbeikommen und sich die Hühner anschauen, die Ställe, den Mobilstall. „Mein Kontrolleur ist mein Kunde“, sagt Kober. Das reicht ihm als Qualitätssiegel.
Trotzdem drängt sich die Frage auf: Was ist Tierwohl? Was ist die beste Haltungsform? „Das kann ich so nicht sagen“, meint er. „Wenn man einkauft, sollte man die Möglichkeit haben, den Betrieb anzuschauen, das ist in meinen Augen wichtig. Wenn ich den Betrieb angucken kann und sehe, wie das Drumherum ist. Es gibt ganz, ganz toll geführte konventionelle Betriebe, es gibt ganz, ganz tolle Biobetriebe. Bei beiden Bereichen gibt es auch Betriebe, die sind, naja…“ winkt er ab. Für ihn zählt, dass man Verantwortung übernimmt und die Kunden Wahlmöglichkeiten haben.
Hof im Hochformat
Ulrich Kober steht neben dem Mobilstall, die Hände in die Hüften gestemmt, und beobachtet die Hühner. Man spürt: Er ist stolz auf seinen Hof. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er seinen Weg gegangen ist. Heute passt das Konzept für ihn. Austausch und ehrliche Kritik sind ihm aber trotzdem wichtig, um besser zu werden, wo es geht. Sein ganzer Betrieb lebe vom Miteinander: Menschen, Tiere, Kundschaft. Und irgendwo dazwischen er selbst. Als Landwirt, der Prinzipien hat und trotzdem rechnet.
Diesen Alltag zeigt er auch auf Instagram. „Einfach Handy draufhalten, hochladen, fertig“, sagt er. Kein Filter, kein Hochdeutsch. Stattdessen schwäbischer Dialekt und der ganz normale Wahnsinn der Landwirtschaft. Die meisten Clips entstehen spontan, irgendwo zwischen Mähdrescher, Hühnerstall und Sortierband. Kober will zeigen, wie es wirklich läuft. Weil er glaubt, dass Landwirtschaft kein Imageproblem hätte, wenn mehr Menschen wüssten, wie viel Arbeit und Gedanken in jedem Ei steckt.
Was Ulrich Kober erzählt, trägt seine Handschrift: Zickzack, wie er es selbst nennt, nicht geradeaus. Ein tägliches Abwägen, zwischen Wirtschaftlichkeit und Haltungssystem, zwischen Kundenwunsch und persönlicher Überzeugung. „Das halbe Leben ist ein Kompromiss“, sagt er irgendwann. Und so ist auch Tierwohl für ihn kein romantisches Ideal, sondern der ernst gemeinte Versuch, in einem Betrieb mit mehreren tausend Hühnern faire Bedingungen zu schaffen.