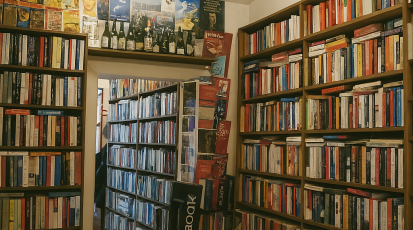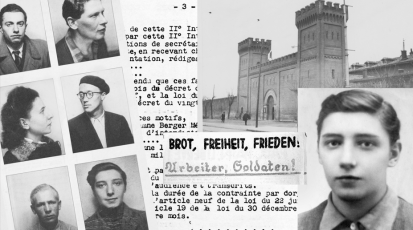„Man kann alles richtig machen und trotzdem kann etwas schiefgehen“
Die Gefahr unter unseren Füßen

Montag, 10.30. Mein Navi lotst mich mithilfe von Koordinaten durch den Sindelfinger Wald. Nach etlichem Verfahren habe ich das Ziel erreicht: das Munitionslager Rohrer Pfad. Mitten im Wald und ohne offizielle Adresse bin ich mit dem stellvertretenden Sachgebietsleiter und Leiter des Zerlegebetriebs Mathias Peterle verabredet.
Es ist ruhig. Statt großen, beladenen Panzern die übers Gelände rollen, grüßen mich zu Fuß gehende Teammitglieder in Dienstuniform. Von tonnenschwerer Munition und Sprengstoff ist hier noch weit und breit nichts zu sehen.
Unser Rundgang beginnt in einem der kleinen Bürogebäude hinter dem großen Eingangstor des Geländes. Von innen erinnert mich die dunkle Holzvertäfelung samt Backsteinkamin und gerahmter Wappen, mehr an ein Vereinsheim in einer Gartenanlage als ein Zwischenlager für tonnenschwere Weltkriegsmunition. „Keiner von uns braucht Action oder jagt dem großen Adrenalinschub hinterher. Es ist eher das Bestreben nach Sicherheit, das uns hier antreibt“, offenbart Peterle.

Peterle leitet ein 24-köpfiges Team, das in ganz Baden-Württemberg die fachkundige Beratung, sowie die Organisation von Einsätzen übernimmt.
Ein Alltag, der keiner ist
"Das Besondere an dem Beruf des Kampfmittelbeseitigers ist, dass es sich dabei um keinen klassischen Ausbildungsberuf handelt", sagt Peterle. Die einzelnen Teammitglieder haben unterschiedlichste Hintergründe. Von Landschaftsgärtnern bis hin zu KFZ-Mechatronikern und ehemaligen Bundeswehrsoldaten ist alles dabei. Was alle miteinander verbindet, ist ihre technische Affinität, das ausgeprägte Verständnis von Zündungssystemen und die Fähigkeit, seinen Tag an spontane Planänderungen anzupassen.
Wenn Rost zur Gefahr wird
In Baden-Württemberg gibt es pro Jahr schätzungsweise zwischen 900 und 1.100 Meldungen von möglichen Kampfmitteln – von verrosteten Granaten bis hin zu tonnenschweren Fliegerbomben. 85 Prozent davon sind tatsächlich echte Munition. „Der Rest“, sagt Peterle, „sind Radkappen, alte Bremstrommeln oder Schubkarrenräder. Im Wasser sehen die täuschend echt aus.“ Hier gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. „Dabei sollte niemand davor zurückschrecken die Nummer des Kampfmitteldienstes zu wählen, denn sollte es sich dabei um Weltkriegsmunition handeln, wird diese mit der Zeit nur gefährlicher“, erklärt Peterle. Das liegt daran, dass durch das jahrelange Dahinrotten, die Hüllen der Zünder langsam aber stetig wegbrechen. Dadurch kann der Sprengstoff auch nach etlichen Jahrzehnten noch detonieren. Handelt es sich bei der gefundenen Bombe allerdings um eine Bombe ohne Zünder ist diese mehr oder minder harmlos, da es sich um Sprengstoff der trägen Art handelt. Um eine Evakuierung kommt man trotzdem nicht herum.
Bombenentschärfung 101
Doch wie genau sieht so eine Bombenentschärfung aus? In den klassischen Sonntagabendnachrichten ist vor allem eins zu sehen: evakuierte Häuser und Straßen, ein großes Polizeiaufgebot. Dabei stecken viel mehr Planung und Vorbereitung dahinter als gedacht.
Eine Bombenentschärfung beginnt in der Regel mit der Evakuierung des betroffenen Bereichs, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Ob und wie evakuiert wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Liegt die Bombe fünf Meter tief oder nur knapp unter der Oberfläche? Ist sie im Wasser oder wurde sie schon bewegt? Der Sprengradius wird grob berechnet: ein Kilometer pro Kilogramm Nettosprengstoff. Bei einer Tonne heißt das – weiträumige Sperrung, Hunderte Menschen müssen raus. Während er erzählt, sitzt Peterle aufrecht, die Hände gefaltet vor sich auf dem Tisch.
Anschließend wird der Zünder der Bombe identifiziert und die Entschärfungsmethode festgelegt. „Zünder ist nicht gleich Zünder“, erklärt Peterle. In den meisten Fällen – rund 95 Prozent – steckt in einer Bombe ein mechanischer Aufschlagzünder. Darin arbeitet eine kleine, aber entscheidende Mechanik: Eine Feder hält die Zündnadel auf Abstand zum Detonator. Erst beim Aufschlag schnellt sie nach vorn, sticht den Detonator an und löst so eine Zündung aus – eine kleine Explosion, die die Hauptladung zur Detonation bringt.
Seltener, aber weitaus tückischer, ist der chemische Langzeitzünder. Er wurde so konstruiert, dass die Bombe zunächst ins Erdreich eindringt und erst Stunden oder sogar Tage später explodieren sollte – bis zu 144 Stunden nach dem Aufschlag kann das andauern. Hier blockieren Scheiben aus Zelluloid den Schlagbolzen. Beim Einschlag zerbricht im Inneren eine Ampulle, gefüllt mit Aceton. Langsam frisst sich die Flüssigkeit durch das Zelluloid, bis dadurch der Schlagbolzen ausgelöst wird.
Für die Entschärfer ist dieser Typ der gefährlichste: Er verfügt über eine Ausbausperre – jede Drehung am Zünder könnte sofort die Explosion auslösen. „Zum Glück sind von den rund 100.000 Tonnen Spreng- und Brandbomben, die im Krieg über Baden-Württemberg abgeworfen wurden, nur etwa ein Prozent mit diesem chemischen Mechanismus ausgebaut“, beruhigt Peterle. Auch hier bleibt Peterle nüchtern. Er erklärt die Mechanik, als handle es sich um eine alltägliche Maschine – und doch blitzt in seinen Augen kurz dieser Respekt auf, den er trotz jahrelanger Erfahrung vor jeder Bombe hat.
Für die fachgerechte Entschärfung kommen zum Teil ferngesteuerte Geräte wie Wasserschneidgeräte oder Raketenklemmen zum Einsatz, um den Zünder zu entfernen oder zu deaktivieren. In manchen Fällen, insbesondere bei Langzeitzündern, kann eine kontrollierte Sprengung notwendig sein, um die Bombe zu entschärfen.
Ein Drama in 5 Akten: Dénouement
Ist die Bombe oder Munition erfolgreich entschärft, wird sie für den Abtransport sichergestellt. „Dabei wird sie in der Dienstelle Rohrer Pfad in einem Munitionsbunker zwischengelagert, bis sie einem privaten Zerlegebetrieb übergeben wird“, erklärt Peters. „Dort wird sie dann entweder in mehrere Einzelteile zersägt oder mithilfe von thermischer Behandlung, also Hitze zersetzt“, erläutert Peters weiter.
Im Jahr 2024 hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg (KMBD) des Regierungspräsidiums Stuttgart insgesamt 13 Blindgänger mit einem Gewicht von jeweils mindestens 50 Kilogramm unschädlich gemacht. Elf dieser Bomben konnten die Fachleute entschärfen, zwei mussten sie durch eine kontrollierte Sprengung beseitigen.
Verständlicherweise ist bei so einem Ereignis das Medieninteresse groß. Der Medienrummel gehört für Mathias Peterle dazu. Nach einem erfolgreichen Einsatz gibt er bereitwillig Interviews, beantwortet Fragen, erklärt technische Details. Doch während einer laufenden Entschärfung ist daran nicht zu denken. „Davor liegen die Nerven blank. Da zählt nur die Konzentration auf den nächsten Handgriff.“
Eine hundertprozentige Sicherheit, dass alles glatt läuft, gibt es nie. Das zeigt die missglückte Bombenentschärfung aus dem Jahr 2010 in Göttingen.
Dabei ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert und hat drei Menschen das Leben gekostet. „Die gemeldete Fliegerbombe detonierte gegen 21.30 Uhr, noch bevor der Kampfmittelräumdienst mit der eigentlichen Entschärfung beginnen konnte. Geplant war diese für 22.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Evakuierung des betroffenen Stadtteils noch nicht vollständig abgeschlossen“, erinnert sich Peters.
Auch wenn kein Fall wie der Andere aufgebaut ist, braucht es Anschauungsmaterial. Dafür begleitet mich Mathias Peterle zum Abschluss zur diensteigenen Mustersammlung direkt neben dem Eingangstor. Kaum öffnet sich die schwere Türe, steigt mir ein kräftiger Metallgeruch in die Nase. Ausgelöst durch die hunderten Ausstellungsstücke, welche die Halle bis unter die Decke füllen. Von Handgranaten bis hin zu verrosteten Fliegerbomben kann die Sammlung mit allem dienen. Ganz am Ende des Raumes steht das „Prachtstück“ des Archivs. Eine Fliegerbombe von 1.8 Tonnen Gesamtgewicht. Satte 1.3 Tonnen davon sind reiner Sprengstoff. Vor der Bombe macht Peterle einen Schritt zurück. Seine Stimme bleibt ruhig, als er sagt: „Respekt habe ich vor solchen Funden immer noch.“ Gerade weil er so sachlich spricht, wirkt dieser Satz umso eindringlicher. Ein seltsames Gefühl macht sich in meiner Brust breit. Ich stehe zwischen Fliegerbomben und Handgranaten aller Art und kann mich nicht von dem Gedanken lösen, dass alles was sich hier um mich herum befindet dazu gedacht war, zum großen Teil Menschen zu töten. „Alles was sich hier befindet ist nicht der generellen Allgemeinheit zugänglich. Hauptsächlich dient es der Weiterbildung und Einarbeitung von unserem Team. Man könnte auch sagen ein Lexikon zum Anfassen", sagt Peters.
In der Stille dieses Archivs, umgeben von Geschichten und Überresten des Zweiten Weltkriegs, wird mir die wahre Bedeutung der Arbeit von Mathias Peterle und seinem Team bewusst. Die tonnenschwere Fliegerbombe am Ende des Raumes ist mehr als nur ein Ausstellungsstück. Sie ist ein stiller Mahner, der die eigentliche Bestimmung dieser Arbeit in Erinnerung ruft: nicht nur die Sicherheit für heutige Generationen zu gewährleisten, sondern auch die Erinnerung an das Grauen zu bewahren, damit dies nie in Vergessenheit gerät.