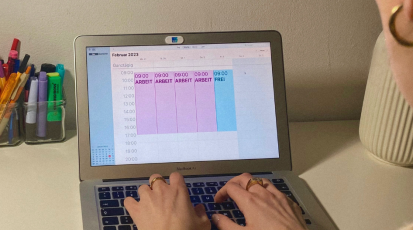„It's not that deep.“
Meine schwerste Last wurde mein größter Vorteil

Ich treffe Kathrin heute zum ersten Mal. Zwischen uns stehen zwei Tassen Kaffee, der Dampf steigt auf und vermischt sich mit der warmen Atmosphäre im Café. Es klappert Geschirr, Stimmengewirr füllt den Raum – Hintergrundrauschen. Wir sind beide Studentinnen, beide im gleichen Alter und wir teilen ein Merkmal, das man uns nicht ansieht: Wir sind CODAs: Children of Deaf Adults.
Es dauert keine fünf Minuten, da verschwimmt die Distanz zwischen uns Fremden. Wir kennen uns nicht, und doch ist da sofort eine Vertrautheit, die fast gruselig ist. Es fühlt sich an, als hätten wir denselben geheimen Clubausweis in der Tasche. Kathrin rührt in ihrem Kaffee, sucht nach Worten für diese eingeschworene CODA-Gemeinschaft: „Das ist wie so eine Sekte, aber halt wirklich. Jeder checkt halt so direkt so auf Anhieb.“
Kathrins Eltern ertaubten früh, Gebärden lernte sie erst in der Grundschule. „Kennst du das, wenn so Leute dann mit deinen Eltern reden und benutzen so ganz komische... Sätze und du weißt ganz genau, das werden sie nicht verstehen?“, fragt sie. Wir lachen kurz auf. Es ist kein fröhliches Lachen, sondern geteilte Verzweiflung. Wir kennen beide den Druck, als Kind Dinge übersetzen zu müssen, die für uns selbst noch zu komplex waren. Das Gespräch fließt wie von selbst zu dem Punkt, der uns beide geprägt hat: das Leben zwischen der „gehörlosen Welt“ und der „hörenden Welt“.
Zwei Welten
Diese Begriffe nutzen Gehörlose oft, um sich abzugrenzen. Für meine Eltern funktioniert Kommunikation nämlich grundlegend anders als für Hörende. Was für uns Hörende der Tonfall ist, ist für sie die Mimik. Das führt zu einer radikalen Direktheit, die Außenstehende oft als aggressiv oder unfreundlich missverstehen. Ich übersetze nicht nur Wörter, ich bin der diplomatische Puffer. Aus der ungeduldigen Gebärde meines Vaters mache ich beim Bankberater ein höfliches: „Mein Vater fragt, ob wir den Prozess beschleunigen können.“ Als CODA steht man zwischen den Fronten, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Wir schalten permanent zwischen zwei Betriebssystemen hin und her: hier die visuelle Direktheit, da die akustische Etikette.
Auch interessant
Warum wir überhaupt dolmetschen mussten, obwohl unsere Eltern sprechen können? Unsere Eltern sind nicht stumm. Sie können sprechen und nutzen ihre Stimme auch im Alltag. Doch für ungeübte Ohren ist ihre Lautsprache oft schwer zu entschlüsseln. „Sie sprechen halt Dinge anders aus“, Kathrin zuckt mit den Schultern. Da sie sich selbst nicht hören, fehlen Endungen, die Grammatik folgt der Gebärdensprache, Wörter werden verschluckt. Für Außenstehende ist das oft unverständlich.
Finanzamt mit Fünf
2006. Der Tresen vor mir ragt auf wie eine Mauer, ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen. Neben mir meine Mutter, die mich fragend ansieht. Über uns thront der Beamte, er blättert Papier um, redet von „Fristversäumnis“ und „Steuerbescheid“.
Ich verstehe die Wörter kaum, aber ich begreife die Dringlichkeit. Ich stammle, rate, versuche eine Welt zu erklären, die mir selbst fremd ist. Ich bin fünf Jahre alt und wurde in das kalte Wasser der Bürokratie geworfen, bevor ich schwimmen konnte.

Wir waren Dolmetscher, Sekretäre und Manager, noch bevor wir das kleine Einmaleins konnten. Wir mussten wichtige Infos zusammenfassen, filtern, was die Welt unseren Eltern sagt und andersherum. Wenn das Telefon klingelte, war es für uns. Wenn Briefe kamen, mussten wir sie erklären.
Dass meine Mutter an Behördendeutsch verzweifelte, lag nicht an ihrer Intelligenz, sondern am System. Bis weit in die 70er Jahre hinein war das Abitur für Gehörlose in Deutschland praktisch unerreichbar. Schulen, oder eher Heime, konzentrierten sich oft rein auf das Sprechen lernen, echte Bildung blieb auf der Strecke. Meine Eltern gehören zu einer Generation, der Bildung systematisch vorenthalten wurde.
Auch interessant
„Finanzen waren ein Riesen-Thema“, erzähle ich. Mit Anfang 20 saß ich zwischen Stapeln an Dokumenten und plante eine Einbauküche. Ich verglich Preise, telefonierte, montierte sie am Ende selbst. Ich habe das Konto meiner Mutter gemanagt, Versicherungen gewechselt, den Antrag für die Sozialwohnung gestellt. Was sich nach einer fleißigen Tochter anhört, war in Wahrheit eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
Eltern für die Eltern
Kathrin erzählt mir von einem Leasing-Auto ihres Vaters. Ein kaputter Monitor, ein missverständliches Gespräch in der Werkstatt, eine Unterschrift zur falschen Zeit. „Am Ende mussten wir viertausend Euro bezahlen“, flüstert sie. Ihr Vater hatte es gut gemeint, wollte es allein regeln. Das Ergebnis waren Schuldgefühle. Bei ihm, weil er Fehler machte. Bei ihr, weil sie nicht dabei war, um ihn zu schützen.
Wir haben gelernt, Bedürfnisse zu erkennen, bevor sie ausgesprochen werden. Aber der Preis war hoch: Parentifizierung – die Umkehr der Eltern-Kind-Rolle. Hat uns das geschadet? Vielleicht. Hat es uns geprägt? Definitiv. Als CODA ist man es gewohnt, Dinge zu regeln. „Machen“ ist unsere Muttersprache. Aber wollen wir das immer?
Es gab Momente, da habe ich meine Rolle gehasst. „Ich hatte mal eine riesige Rebellions-Phase als Teenager“, gestehe ich Kathrin. Ich weigerte mich zu gebärden. Doch egal, wie sehr ich mich damals dagegen wehrte, ich konnte meine Herkunft nie vergessen.
Während wir reden, passiert etwas, das Außenstehende vielleicht irritieren würde. Wir halten intensiven Augenkontakt, lassen den Blick des Anderen keine Sekunde los. Unsere Hände liegen nicht still neben den Kaffeetassen, sie unterstreichen jedes Wort und malen Begriffe in die Luft. Es ist das Erbe unserer Eltern: Sprache ist für uns nicht nur Hören, sondern Sehen.
Hier liegt der Wendepunkt unseres Gesprächs. Was uns früher als Last erschien, ist im Erwachsenenleben unsere schärfste Waffe. Wir haben Fähigkeiten entwickelt, für die andere jahrelange Coachings brauchen.
Szenenwechsel. Ich sitze nicht mehr am Küchentisch meiner Mutter, sondern im verglasten Konferenzraum meiner Firma. Um mich herum nervöses Tippen auf Laptops, angespannte Gesichter. Es ist Montag, 9 Uhr, Krisensitzung. Der wichtigste Kunde droht am Telefon, das Projekt abzubrechen. Seine Stimme überschlägt sich, er brüllt durch den Lautsprecher. Im Raum riecht es förmlich nach Angst. Ich lehne mich zurück. Mein Puls? Ruhig. Ich beobachte die Panik fast wie eine Zuschauerin. Lärm, Wut, Überforderung? Das ist kein Weltuntergang, wenn man früher einem Gerichtsvollzieher erklären musste, dass die Eltern ihn nicht hören können.
Personalabteilungen nennen das heute „Resilienz“ oder „Agilität“ und schicken Mitarbeiter dafür in teure Wochenend-Coachings. Für uns CODAs war das kein Soft Skill für den Lebenslauf, sondern eine Überlebensstrategie. Wir haben gelernt, Stimmungen im Raum zu lesen, bevor das erste Wort fällt und diplomatisch einzugreifen, wenn Kommunikation scheitert. Ich übersetze nicht mehr nur Gebärden, sondern zwischen Marketing und IT, zwischen Problem und Lösung. Wir spüren Missverständnisse, bevor sie entstehen.

Heute hat sich das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir gewandelt. In den letzten vier Jahren haben wir gemerkt, wie sehr wir uns gegenseitig schätzen. Unsere Eltern blicken heute anders auf uns. Kathrins Eltern sind „super stolz“, dass sie die Erste in der Familie ist, die studiert. Bei meinem Bachelor-Abschluss wurde der WhatsApp-Status meiner Mutter mit Bildern geflutet.
Einzigartig stark
Kathrin stellt ihre Tasse ab. Das helle Klirren des Porzellans holt uns zurück. Wir blicken auf den Bodensatz unseres Kaffees, der längst kalt geworden ist, während um uns herum das Stimmengewirr des Cafés wieder lauter wird, als hätte jemand die Stummschaltung aufgehoben. Wir haben alles gesagt und uns verstanden, ohne alles erklären zu müssen. Wir schieben die Stühle zurück und ziehen die Reißverschlüsse unserer Jacken hoch.
Als wir das Café verlassen, fühlt es sich nicht an, als würden wir uns erst seit einer Stunde kennen. Wir umarmen uns herzlich, ich verabschiede mich von einer Verbündeten. Der Einblick in beide Welten hat uns stark gemacht. „Ist halt auch einfach was, ich würde mal sagen, Einzigartiges“, hat Kathrin vorhin gesagt. Und sie hat recht. Wir müssen uns nicht für eine Welt entscheiden.