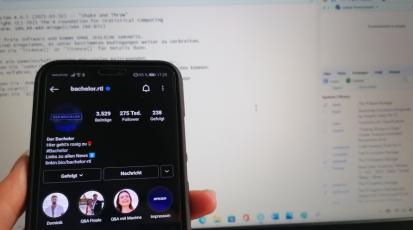Haben wir das Warten verlernt?

Mein Cousin ist eine dieser ungeduldigen Personen, die beim Warten förmlich verglühen. Letztens musste er warten. Und zwar auf ein Paket. Das Zustelldatum hat sich mit jedem Blick in die Liefer-App um eine Stunde nach hinten verschoben. Mit jedem Tag wurde er ungeduldiger. Seine Eltern behaupten jedes Mal, er habe das Warten nie wirklich gelernt.
Wie denn auch? Während die „80er-Party-People“ teilweise eine Woche lang auf die neue Folge ihrer Lieblingsserie warten mussten, streamen wir heute einfach die komplette Staffel an einem Tag auf Netflix. Damals, erzählten mir meine Eltern, habe man drei Stunden lang Radio gehört, um auf diesen einen bestimmten Song zu warten, den man unbedingt aufnehmen wollte – und dabei gehofft, der Moderator würde am Ende nicht dazwischenquatschen. Heute klicken wir uns durch eine scheinbar endlose Spotify-Bibliothek und stellen uns unsere eigene Playlist zusammen. Und das Beste: Wir können sie immer und überall abspielen. „Warten“ ist in unserer Gegenwart eher ein nostalgisches Konzept als gelebte Realität.
Warten heute vs. Warten damals
Der Duden definiert Warten als „dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint." Wenn ich also wieder mal seit einer halben Stunde am Bahnhof stehe und dem Eintreffen meiner Bahn entgegensehe, entspricht das ziemlich genau dieser Definition. Oft ärgert es mich, dieses Warten. Warten bedeutet für mich: Zeitverlust. Zeitverschwendung. Zeit, die ich nicht habe. Den Gesichtern der anderen Wartenden nach zu urteilen, scheine ich mit dieser Haltung nicht allein zu sein. Meine Eltern dagegen erzählen das Warten anders. „Wenn wir früher gewartet haben“, sagen meine Eltern, „konnten wir nicht einfach Musik anmachen oder unsere Instagram-Feeds durchscrollen. Stattdessen haben wir uns auf das gefreut, was nach dem Warten kam: Auf das Treffen mit Freunden, aufs Nachhausekommen, aufs Runterkommen. Oft haben wir uns einfach mit den anderen Leuten um uns herum unterhalten. Diese spontanen Gespräche waren meist die besten. Das traut man sich heutzutage gar nicht mehr. Alle wirken gestresst und mies gelaunt, wenn sie irgendwo warten müssen.“
Wo liegt das Problem?
In einer Gesellschaft, in der es immer höher, schneller, weiter geht, erscheint das Warten wie ein Defekt des Systems. Warten wird schlichtweg nicht toleriert. Ein Bug, den es auszumerzen gilt.
In anderen Kulturen ist das Warten vielmehr fester Bestandteil des Lebens. In Italien zum Beispiel sind Fahrpläne meiner Erfahrung nach oft eher freundliche Vorschläge als verbindliche Abmachungen. Sie scheinen wohl eher aus dem Grund zu existieren, dass es in anderen Ländern auch welche gibt – man wollte es den Touristen eben heimisch machen. Ich erinnere mich gut daran, wie ich in einem italienischen Dorf an einer Haltestelle stand und auf einen Bus wartete, der „in fünf Minuten“ kommen sollte – seit einer halben Stunde schon. Ich fing an, meine übliche Warte-Routine abarbeiten zu wollen … aber ich hatte weder Termine zu organisieren noch Meetings zu vereinbaren oder irgendwelche To-dos zu planen. Automatisch fühlte ich mich wie die einzige Person, die nichts Produktives mit ihrer Zeit anzufangen hat – doch als ich mich umschaute, fiel mir auf, dass die Einheimischen dort genau dasselbe wie ich taten: nichts. Man plauderte fröhlich, man wartete gemeinsam. Niemand schimpfte, niemand googelte Alternativen. Und irgendwann kam der Bus dann eben. Vielleicht sind nicht die Fahrpläne dort dekorativ – vielleicht sind unsere Erwartungen hier einfach zu präzise.
Neulich stand ich wieder am Bahnhof. Verspätung – natürlich. Ich wollte mich gerade aufregen, da sah ich meinen Cousin neben mir. Er schaute auf die Anzeigetafel, seufzte – und dann grinste er.
„Immerhin kommt sie irgendwann“, sagte er.
Hinweis:
Dieser Beitrag ist Teil des Kolumnenformats „Früher war alles besser … oder?“ Weitere Folgen der Kolumne sind: