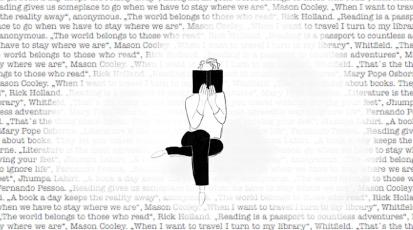Sonntage waren früher besonders für mich. An diesem Tag fuhren meine Eltern mit mir immer zu meinen Urgroßeltern. Gemeinsam saßen wir im Wohnzimmer, es gab immer etwas zum Essen. Danach tranken wir gemeinsam Chai (auf Deutsch „Tee“) zusammen mit verschiedenen russischen Süßigkeiten. „Wie läuft es in der Schule? Du gehst noch auf das Gymnasium, oder?“, fragte mein Uropa, den ich immer Deduschka nannte, mit strahlenden Augen. Immer wieder beantwortete ich seine Frage mit „Gut“. Diese ständige Fragerei hat mich nach einer Weile extrem gestört. Warum stellte er mir immer dieselbe Frage? Selbst noch während meines Studiums stellte er diese immer wieder. Mittlerweile verstehe ich aber, dass hinter der ganzen Fragerei viel mehr steckte als Smalltalk. Es ging um die Geschichte meiner Urgroßeltern, die alles auf einen Schlag verloren haben.
Ich wurde in eine Familie von Russlanddeutschen geboren. Anfangs störte es mich nicht, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Diese Einstellung verschwand aber schnell. Schon im Kindergarten wurde ich von einer Erzieherin deswegen gehänselt. So verwendete ich ab und zu russische Wörter, weil sie mir im Deutschen in dem Moment nicht eingefallen sind. Das gefiel dieser Erzieherin gar nicht. So spürte ich nicht nur täglich ihre Abneigung mir gegenüber, sie überzeugte auch meine Eltern, dass ich nicht richtig sprechen könne und deswegen unbedingt zur Logopädie müsste. Meine Eltern haben ihr das geglaubt, sie sind ja keine deutschen Muttersprachler und konnten das zu dem Zeitpunkt selbst nicht beurteilen. Die Logopädin, die ich besuchte, meinte daraufhin, dass ich keine Probleme beim Sprechen hätte und sie nicht verstehen würde, warum ich überhaupt in Behandlung sollte.
Die Russlanddeutschen kamen hauptsächlich im 18. Jahrhundert unter Zarin Katharina II. nach Russland. Sie erließ 1763 ein Einladungsmanifest, das Siedlern Privilegien wie Religionsfreiheit, Steuervorteile und kostenloses Land versprach. Sie siedelten sich zunächst an der Wolga und später auch in der Schwarzmeerregion an. In ihren Kolonien bewahrten sie ihre Sprache und Kultur und wurden erfolgreiche Landwirte. Durch den zweiten Weltkrieg und besonders unter Stalin wurden die Russlanddeutschen verfolgt und deportiert.
Irgendwann war mir das alles zu viel, sodass ich mich schon im Kindesalter für das schämte, was meine Familie und mich anders machte: die Sprache, die wir sprachen, die Gerichte, die wir zu Hause aßen, die Geschichten, die ich nicht hören wollte. Wenn man mit mir früher Russisch sprach, erwiderte ich immer frech „Und jetzt auf Deutsch“. Dabei meinte ich es eigentlich nicht böse. Ich war einfach nicht bereit, mich mit der Vergangenheit meiner Vorfahren auseinanderzusetzen und die Besonderheit zu akzeptieren. Ich wollte einfach nur dazugehören. Doch je älter ich werde, desto mehr spüre ich, dass ich diese Teile brauche, um mich selbst zu verstehen. Ich will wissen, was meine Vorfahren durchgemacht haben, wie sie gelitten und überlebt haben, und warum ich heute hier bin.
Das erste Mal, dass ich mich mit der Geschichte der Russlanddeutschen auseinandergesetzt habe, war in der Mittelstufe. Im Geschichtsunterricht bekamen wir die Hausaufgabe, einen Zeitstrahl über unsere Familiengeschichte zu erstellen. So besuchte ich alle meine Groß- und Urgroßeltern und fragte sie aus. Ein wenig verwirrt und mit Blicken, die aus einer Mischung von Schmerz und Scham bestanden, erzählte meine Uroma, für mich Baba, über ihre Jugend. Sie hatte dennoch immer ein freundliches Lächeln auf ihrem Gesicht. Für diese Reportage besuchte ich beide nochmals, um auch die Fragen zu stellen, die ich mich damals nicht getraut habe zu stellen.
Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland die Sowjetunion angriff, erließ Stalin ein Dekret, das alle Deutsche in Russland zu Verrätern erklärte. Das führte zu massiver Gewalt, Enteignung und Verschleppung der Russlanddeutschen. Das haben auch meine Urgroßeltern mitbekommen. Zu dem Zeitpunkt waren sie gerade mal Teenager. Mit Viehwaggons wurden sie in ein Arbeitslager in der Nähe von Tomsk in Sibirien deportiert. Von dem Tag an waren sie gezwungen, in der Trudarmee, ein System der Zwangsarbeit, in Kohleschächten zu arbeiten. Jeden Tag mussten sie einen sechs Kilometer langen Fußmarsch bewältigen, um zu den Kohleschächten zu gelangen. Manchmal lag der Schnee so hoch, dass man nur mit großer Mühe durchkam. Bei der Arbeit angekommen, wurde überprüft, wer da war. „Jedes Mal bevor wir runter mussten, mussten wir unsere Arbeitsnummer aufsagen“, erinnert sich mein Deduschka. Bis heute kann er sich ganz klar erinnern, welche Nummer er hatte. „Ich hatte zum Glück eine leichte Nummer: 5353“, erzählte er mir schmunzelnd. Danach ging es tief unter die Erde. 12 Stunden verbrachten sie unter Tage. Meine Baba war 100 Meter unter der Erde und trug die Lampen, sodass sie und die Arbeiter in dunklen Schächten etwas sehen konnten. Deduschka belud 100 Meter tiefer die Kohlewaggons, die von Pferden gezogen wurden. „Die Pferde durften nie mehr an die Oberfläche“, erzählte er mir. „Nach ein paar Monaten konnten sie nichts mehr sehen. Sie lebten nur noch in der Dunkelheit.“
Die Vergangenheit, die einen immer einholt
„Sowas kann man nicht vergessen. Es war hart und gefährlich“, betont meine Baba. Oft erzählt sie, dass sie immer Angst hatte, dass der Schacht einstürzen würde und sie nicht mehr lebend rauskäme. Diese Angst ist auch berechtigt gewesen. Eines Tages traf ein Stein, der von der Decke fiel, auf Deduschka. „Danach war ich lange krank. Ich durfte aber nicht nach Hause, ich war in der Balniza (auf Deutsch „Krankenhaus“).“ Sein Schädel war gebrochen und auf einem Auge verlor er sein Augenlicht. Zwei Monate musste er nicht arbeiten, als er aber entlassen wurde, musste er direkt wieder unter Tage.
Meine Urgroßeltern trafen sich das erste Mal im Lager. Deduschka war 14 Jahre, Baba inoffiziell 16. Ihre Familie hatte ihre Dokumente fälschen lassen, damit sie erst später ins Lager musste. Zu der Zeit war Deduschka sehr mager und schwach und musste schwere Arbeit leisten. Baba machte sich Sorgen. Sie schenkte ihm jeden Abend immer ein Stück von ihrem Brötchen, sodass er die schwere Arbeit im Lager überleben konnte. So lernten sie sich nicht nur kennen, sondern auch lieben.
Als ich damals meinen Zeitstrahl meiner Klasse vorgestellt hatte, wurde ich mit schrägen Blicken angeschaut. Zuvor hatten alle davon berichtet, dass ihre Familie schon immer in Deutschland in Frieden gelebt haben. Dass ich mit einer Geschichte komme, in denen Menschen Zwangsarbeit leisten mussten, damit hat keiner gerechnet. Keiner, nicht mal ich, konnte sich vorstellen, gegen den eigenen Willen festgehalten oder hungern zu müssen. Auch kannte ich von den Besuchen meiner Urgroßeltern, dass der Tisch immer überfüllt von Speisen war – mit Olivier, Borschtsch, Brot und natürlich Nachtisch. Und jedes Mal sahen sich meine Urgroßeltern mit liebenden und stolzen Blicken an und beobachteten, wie wir alles aufaßen. Nach dem Essen wurden wir Urenkel immer mit Geschenken und Süßigkeiten überhäuft. Sie waren einfach froh, dass wir in Frieden und ohne Sorgen leben können.
Bis heute erinnern sie sich an ihre Armut gut. Mein Deduschka hatte bis zu seinem kürzlichen Tod die Angewohnheit, das Geld in seinem Portemonnaie mehrfach am Tag zu zählen, mit der Angst, dass ihm jemand etwas gestohlen hätte. Auch konnten sie sich beispielsweise auch keine Hochzeit leisten. Dennoch heirateten sie klein im Arbeitslager. „Es war keine richtige Hochzeit. Wir sind auf den Markt gegangen, haben für 30 Rubel eine Schüssel voller Kartoffel gekauft und haben das gegessen. Das war unser Hochzeitstag“, erzählt Baba nüchtern.
Das war auch einer der Fragen, die ich mich nie getraut habe zu stellen. Warum genau verstehe ich auch nicht. Vielleicht wollte ich meinen Urgroßeltern auch einfach nicht zu nahetreten. Baba lächelte mich aber nur an, als ich ihr die Frage stellte. Meine Angst war komplett unbegründet. „Wenn es trübe Tage gibt, muss man immer weiter vorwärts. Nicht zurückschauen, sondern immer weiter nach vorne.“ In der Vergangenheit erwähnte sie auch einmal, dass das Einander-haben ihr auch sehr geholfen hat, weiterzumachen.
Diese Worte waren eine Art Lebensmotto für die beiden. Fast 77 Jahre waren sie miteinander verheiratet. Ihre Liebe machte trotz der schweren Arbeit keinen Halt. Noch in der Zeit, als sie in der Trudarmee waren, gebar meine Baba zwei Kinder. Direkt nach der Geburt wurde sie jedoch gezwungen, wieder arbeiten zu gehen. Auf die Kinder aufgepasst hat eine Bekannte, während beide meiner Urgroßeltern wieder unter der Erde arbeiteten. Auch das Auswandern nach Deutschland 1993 ließ ihre Liebe nicht erschüttern.
Mein Puzzle habe ich noch immer nicht lösen können. Bis heute fühle ich mich wie zwischen zwei Welten. Aber mittlerweile akzeptiere ich meine Wurzeln immer mehr und erzähle sehr gerne darüber. Vielleicht wird es mir nie möglich, mein eigenes kleines Rätsel namens Identität zu lösen, aber die Erinnerungen und Erlebnisse meiner Urgroßeltern möchte ich niemals in Vergessenheit geraten lassen. Wenige wissen, was Russlanddeutsche sind. Ich werde auch immer als Russin abgestempelt, obwohl ich die Sprache nicht fließend spreche und auch noch nie in Russland war. Auch wurde in der Schule über diese Ethnie nie aufgeklärt, obwohl diese Gemeinschaft ein Teil der deutschen Geschichte ist. Dieses Vermächtnis werde ich immer mit mir tragen und mit voller Kraft versuchen, dass dies nicht in Vergessenheit gerät. Und egal wie schwer und kalt mein Weg in Zukunft sein wird, die Geschichte erinnert mich immer: Selbst im Dunkeln findet man irgendwann mal Licht und Wärme.