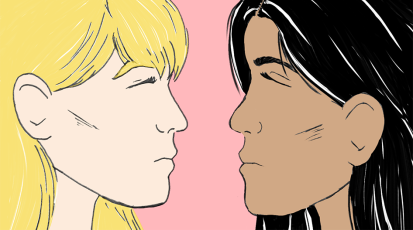Wenn Liebe dich arm macht

Die sogenannte „Queer Pay Gap“ beschreibt die durchschnittliche Lohnlücke im Bruttostundenlohn zwischen queeren und nicht-queeren Menschen. Dabei ist sie längst kein Randphänomen mehr. Im Gegenteil: Sie ist die stille Quittung für das Verlassen der heteronormativen Komfortzone.
Betroffen sind längst nicht nur schwule und bisexuelle Männer. Die Lücke zieht sich quer durch das Alphabet der queeren Identitäten. Fast alle Menschen, die sich unter dem Label LGBTQIA* versammeln, spüren die Auswirkungen dieser Ungleichbehandlung.
LGBTQIA* - Wer steckt hinter den Buchstaben
L – Lesbian: Weiblich gelesene Personen, die sexuelle Anziehung zu weiblich gelesenen Personen empfinden
G- Gay: Männlich gelesene Personen, die sexuelle Anziehung zu männlich gelesen Personen empfinden
B- Bisexuell: Menschen, die sowohl sexuelle Anziehung zu männlich als auch weiblich gelesenen Personen empfinden
T- Transgeschlechtlich: Menschen, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugeordneten biologischen oder sozialen Geschlecht identifizieren
Q- Queer: Überbegriff für alle Menschen, die sich nicht in die Cis Hetero normative Gesellschaft passen
I- Intergeschlechtlich: Menschen deren körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig mit „üblichen“ medizinischen Geschlechtskategorien übereinstimmen
A- Aromantisch/ Asexuell: Menschen, die keine oder wenige romantische/ sexuelle Anziehung zu anderen empfinden
Eine Lohnlücke, die sich nicht weg rechnen lässt
Zwei Euro. Stunde für Stunde. Tag für Tag. Was klingt wie Kleingeld, summiert sich über Jahre zu einer stillen, systematischen Erniedrigung. Basierend auf dem Bruttostundenlohn ermittelte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Gehaltsdifferenz von fünf bis zu 15 Prozent für schwule und bisexuelle Männer.
Dabei betont Studienautor Martin Kroh, die Differenz beim Stundenlohn lasse sich weder durch Qualifikation noch durch Berufserfahrung erklären. Das Gegenteil ist der Fall. Die Studie zeigt homo- und bisexuelle Menschen haben im Schnitt häufiger das (Fach-) Abitur.
Laut einer Studie der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld aus dem Jahr 2020 verdienen homosexuelle Frauen im Durchschnitt elf Prozent weniger als ihre heterosexuellen Kolleginnen. Besonders bitter dabei ist: Lesbische Frauen sitzen häufiger in der Chefetage. In der Stichprobe der Studie fanden man heraus das 46 Prozent homo- und bisexuellen Frauen eine Führungsposition inne hatten. In der Vergleichsgruppe der heterosexuellen Frauen waren es nur 36 Prozent.
Lesbische Frauen in der Arbeitswelt sind sichtbarer denn je, ob in der Chefetage oder im Großraumbüro. Dennoch werden sie übersehen, wenn es um das Gehalt geht. Denn wer als Frau Frauen liebt, bricht mit der gesellschaftlichen Norm und wird deswegen zur Kasse gebeten. Und das nicht im metaphorischen Sinne, sondern mit der Zahl auf dem Lohnzettel.
Geldstrafe für mehr Geschlechtervielfalt
Forschende aus den Niederlanden konnten auch bei transgeschlechtlichen Personen eine Queer Pay Gap feststellten, doch wirken hier unterschiedliche Faktoren. Der Stundenlohn von Trans*Frauen verringert sich im Schnitt um zwölf Prozent nach einer Transition. Verursacht wird das durch zwei überlagernde Effekte: Zum einen erfahren sie transfeindliche Diskriminierung, zum anderen wirkt zusätzlich die klassische Gender Pay Gap. 43 Prozent von ihnen gaben an, in den vergangenen zwei Jahren am Arbeitsplatz Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Beide Aspekte drücken den Lohn jeweils um etwa sechs Prozent.
Bei Trans* Männern hingegen gleichen sich diese Effekte aus. Die Abwertung durch transfeindliche Diskriminierung wird durch die strukturelle Aufwertung männlicher Geschlechtsidentität kompensiert.
Gerade bei Trans* Personen zeigt sich, wie eng Diskriminierung und ökonomische Bewertung verknüpft sind. Es entlarvt sich ein System, das Männlichkeit sozial und monetär belohnt und jegliche Abweichungen bestraft. Wer sich nicht in vorgefertigte Geschlechterkisten einsortieren lässt, zahlt dafür oft mit barer Münze. Als hinge an Nichtkonformität ein Preisschild.
Berufswahl – Der Weg der geringsten Diskriminierung?
Neben finanziellen Nachteilen kämpfen queere Menschen oft mit fehlender Akzeptanz am Arbeitsplatz. Laut einer DIW-Umfrage sind ungefähr 30 Prozent der LGBTQIA*-Personen am Arbeitsplatz nicht geoutet, im Bau- und Agrarsektor sogar fast 42 Prozent. Im Gesundheits- und Sozialwesen, die hingegen deutlich schlechter bezahlt sind, sind drei Viertel offen mit ihrer Identität. Die ungleiche Verteilung queerer Menschen über Branchen hinweg, lässt also auf strukturelle Hürden im Arbeitsmarkt schließen. Sei es durch zu geringe Repräsentation oder der Angst vor Diskriminierung, queere Menschen sind nicht gleichberechtigt in der Arbeitswelt.
Mit offenen Armen und verschlossenen Herzen
Einladungen zur Weihnachtsfeier mit der Partnerperson werden zur stillen Zwickmühle, das Gespräch über das Wochenende zum Slalomlauf um die eigene Wahrheit.
Die Angst vor Ausgrenzung oder Nachteilen sitzt oft tiefer als der Wille nach Sichtbarkeit. Also schweigt man. Lächelt. Und verbiegt sich leise, während ein Teil der eigenen Identität im Schatten bleibt – unerzählt, ungeteilt und unerwünscht.
Die daraus folgende soziale Isolation wirkt sich nicht nur auf die Lebensqualität aus, sondern kann psychisch belasten sein. Es ist bewiesen, dass queere Menschen eine hohe Anfälligkeit für depressive Erkrankungen haben. Faktoren wie Stigmatisierung und Diskriminierung verursachen laut Studie des DIW chronische Stress bei queeren Menschen.
In einer Welt voller Unternehmen, die jeden Juni alles daransetzten, ihre Logos und Produkte zu einem Meer aus Regenbogenflaggen und Pride Collection zu machen, sollte Queerness kein Risiko, sondern eine Selbstverständlichkeit sein.

Arbeit, Ausgrenzung, Altersarmut?
Und auch der Blick ans Ende des Regenbogens ist nicht rosig. Wo in den Märchen ein Topf Gold auf den Helden wartet, finden viele LGBTQI* Menschen nur den Ausblick auf eine spärliche Rente. Statt einem Märchenende wartet auf sie ein Lebensabend zwischen Geldsorgen und Gebrechlichkeit.
Ein geringeres Einkommen während der Erwerbstätigkeit führt zwangsweise dazu, dass weniger Budget für andere Dinge wie Kultur, Hobbies oder das Wohnen in guter Lage da ist. Das führt zu einer Rolle als sozialer Außenseiter und verstärkt das Gefühl, keinen Platz in der Gesellschaft zu haben. Es erhöht langfristig das Risiko, an Altersarmut zu leiden.
In einer nicht repräsentativen Stichprobe aus dem Jahr 2012 fanden Forschende heraus, dass fast ein Drittel der homosexuellen Menschen über dem Alter von 50 Jahren in den USA an der Armutsgrenze oder darunter lebten. Noch gravierender war die Lage für transgeschlechtliche Personen. Die Studie ergab, dass fast die Hälfte von ihnen unter der Armutsgrenze lebte. Auch wenn das deutsche System wenig Vergleichspunkte mit dem amerikanischen Rentensystem zulässt, ist das Ergebnis der Erhebung dennoch trotz ein Indikator für die Auswirkungen von Lohndiskriminierung im Alter.
Wenn die Queer Pay Gap und die damit verbunden Folgen zur Norm wird, ist das mehr als ein Armutszeugnis. Es ist ein stillschweigendes Urteil über Wert und Würde, gesprochen von einer Gesellschaft, die Gleichheit predigt, aber Ungleichheit lebt.
Veränderung ist möglich, nur unbequem
Studien zeigen: Queere Menschen outen sich häufiger in Branchen, in denen sie stärker vertreten sind, etwa im Gesundheits- und Sozialwesen. Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Doch das allein reicht nicht. Die ständige Doppelbelastung zwischen Anpassung und Authentizität hinterlässt Spuren. Viele queere Menschen sind von psychischen Belastungen, sozialer Isolation und beruflichen Einschnitten ungewollt betroffen.
Was es braucht, sind klare und verbindliche Maßnahmen: Gehaltstransparenz, gesellschaftliche Aufklärung und eine Unternehmenskultur, in der Offenheit nicht zum Risiko, sondern zur Stärke wird. Denn wer Vielfalt feiert, muss auch für sie kämpfen.