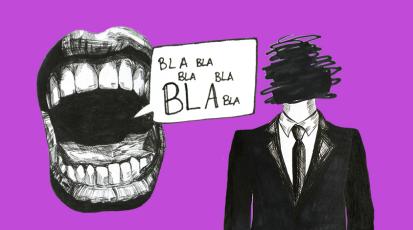Mein ominöses Gegenüber ist der Performancekünstler Daniel Beerstecher. Im Rahmen seines Projekts „Ich höre zu“ befindet sich der in Stuttgart, Rio de Janeiro und auf Reisen arbeitende Kunstschaffende und Meditationslehrer seit Ende Juni auf einer einjährigen Wanderung durch Deutschland. Was seine Reise von einer ambitionierten Outdoor-Aktivität unterscheidet? Während des ganzen Jahres will Beerstecher schweigen. „Die Grundidee ist es, der Kraft des Zuhörens auf eine radikale Weise Raum zu geben“, schreibt mir Beerstecher in einer Mail. In einem von Selbstdarstellung und Lärm geprägten Zeitalter werde diese Kunst oftmals übersehen – seine Reise betrachtet er deshalb als ein Gegenmodell und hofft auf Begegnungen, in denen er vollkommen präsent, aber gleichzeitig still sein kann. „Durch das Schweigen entsteht eine ungewohnte Qualität des Zuhörens“, fügt er hinzu. „Indem ich mich selbst aus dem Gespräch herausnehme, bekommen mein Gegenüber und alles Andere, was in der Stille auftaucht, mehr Raum." Finanziert wird das Projekt durch Kooperationspartnerschaften mit Vereinen, Galerien und städtischen Institutionen, sowie durch die Unterstützung von Stiftungen und Spendeneinnahmen. Gleichzeitig lebt das Projekt von dem Engagement von Privatpersonen, die Beerstecher für ein Abendessen oder eine Übernachtung bei sich zuhause aufnehmen - und ihm somit eine Alternative zu dem Zelt bieten, das den Künstler auf seiner Wanderung stets im Rucksack begleitet.
Peinliche Stille oder Tiefenentspannung?
Doch wie verändern sich die Selbstwahrnehmung, die eigenen Gedankenprozesse und das Gefühl sozialer Zugehörigkeit, wenn man für einen längeren Zeitraum schweigt? Ab wann tritt das ein, was wir oftmals als „peinliche Stille“ bezeichnen? Und was macht es mit mir, wenn mir eine Person den vollständigen Raum überlässt und ohne ungefragte Ratschläge und Urteile einfach zuhört? Um meine Fragen zu beantworten, beschließe ich, Beerstecher einen Tag lang zu begleiten. Und ein paar Mails später stehe ich bereits an einem sonnigen Dienstagmorgen an dem Ort, an dem Beerstecher auf mich wartet: In Rheinzabern, einer kleinen Gemeinde hinter Karlsruhe. In ihren menschenleeren, mit Reihenhäusern, Spitzengardinen und Vorgärten bevölkerten Straßen steckt eine Stimmung, die ich irgendwo zwischen meditativer Ruhe und Spießertum verorte. Ich werfe einen Blick in die Ferne und entdecke einen Mann, der mit seinem Fischerhut, seiner kurzen Hose und seinem überdimensionalen Outdoor-Rucksack auch als Pfadfinder durchgehen könnte. Winkend und mit einem offenen Lächeln auf den Lippen kommt er auf mich zu – vollkommen wortlos, wie sich versteht. Mir wird sofort klar: Vor mir steht mein heutiger Wegbegleiter.
Der Versuch, Grenzen auszuloten, sich in Extremsituationen zu begeben und dennoch ganz bei sich zu bleiben, zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. „Ich bringe mich vielleicht bewusst in schwierige Situationen, die ich unter dem Deckmantel der Kunst als eine Art Experiment verpacke“, schreibt er in seiner Mail. „Alles, was ich bisher bewältigen konnte, gibt mir im Alltag eine gewisse Ruhe und Leichtigkeit. Dann kann ich mir zum Beispiel sagen: Du bist mit einem Segelboot auf Rädern über die Straßen Patagoniens gesegelt – also stell dich jetzt nicht wegen einer blöden Steuererklärung an“, so Beerstecher.
Ein wortloses Kennenlernen
Was in der Regel mit einem mehr oder weniger einstudierten Wortwechsel beginnt, gestaltet sich bei unserer ersten Begegnung etwas anders: Ich stelle mich vor, fasse kurz zusammen, in welchem Rahmen ich hier bin, wir beide lachen etwas verlegen. Dann erkläre ich ihm meinen Plan für den heutigen Tag: Ich möchte vorerst mit ihm schweigen, beobachten, was die Stille mit mir macht und mich in seine Perspektive hineinversetzen. Irgendwann im Laufe des Tages will ich dann einen Gedanken mit ihm teilen, um herauszufinden, wie es sich anfühlt, mich einem stillen Zuhörer zu öffnen. Er nickt betont – und zieht ein E-Book inklusive Touchpen aus seiner Tasche. Obwohl sich Beerstecher während seines Schweigejahrs nicht durch gesprochene Worte ausdrückt, äußert er sich schriftlich und kommuniziert nonverbal – durch Mimik, Gestik und Handzeichen. „Bist du bereit?“, steht auf dem Display. Ich nicke, und schon ziehen wir los.
Unser Weg – eine Tageswanderung bis an das Seegrundstück einer Freundin Beerstechers, das in der Gemeinde Sondernheim liegt – führt uns über ausgetrocknete Felder, schattige Waldwege, durch ausgestorbene Käffer und entlang des Rheins. Und bereits nach etwa einer Viertelstunde des stillen Wanderns stelle ich fest: Ich nehme die Landschaft, die Geräusche und Gerüche, aber auch meine eigenen Gedanken intensiver wahr. Trotz Beerstechers Schweigen – oder vielleicht gerade deshalb – entsteht eine ruhige, angenehme Stimmung, in der ich meinen Gedanken in einem flow-artigen Zustand nachgehen kann.
Die Psychologie des Zuhörens
Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es keinen klaren Konsens im Hinblick auf die Frage, wie viel Prozent der Kommunikation nonverbal stattfindet. Coaches und Medienquellen bedienen sich oftmals der sogenannten „7-38-55-Regel“ des US-amerikanischen Psychologen Albert Mehrabian, die besagt, dass nur 7 Prozent der Kommunikationswirkung auf das eigentlich Gesagte, 38 Prozent auf den Tonfall und 55 Prozent auf die Körpersprache zurückzuführen seien. Und obwohl die Studie oftmals falsch zitiert und als allgemeingültige Formel fehlinterpretiert wurde, ist sicher: Nonverbale Kommunikation macht einen signifikanten Teil unseres sozialen Verhaltens aus.
Trotzdem frage ich mich, inwiefern ein offener, flüssiger Redefluss überhaupt entstehen kann, wenn das verbale Feedback fehlt. Um uns beim Sprechen nicht nur gehört, sondern auch verstanden zu fühlen, benötigen wir laut der Psychologin Margarete Imhof das, was in der Fachsprache als „Back-Channeling“ bezeichnet wird: Verbale und nonverbale Reaktionen, die einen positiven Einfluss auf unsere Emotionen und unseren Redefluss ausüben. „Wenn sich eine Person einer anderen gegenüber öffnet, ist das – je nach Thema – mit einem Risiko der Ablehnung verbunden und erzeugt Verunsicherung“, erklärt die Psychologin, die ihren Forschungsschwerpunkt unter anderem auf die Psychologie des Zuhörens legt. „Das ist ein unangenehmes Erleben und daher suchen Personen beim Sprechen nach Hinweisen, dass sie sich in einem „safe space“ befinden.“ Diesen sicheren Raum schaffe die zuhörende Person durch die Kombination aus nonverbalen und verbalen Reaktionen. „Nonverbale Äußerungen sind der „Schmierstoff“ für Sprechen und Zuhören. Wenn die zuhörende Person nonverbal verstummt, verstummt auch die sprechende Person“, erläutert Imhof. Gleichzeitig betont sie: „Beide Formen der Äußerungen – verbal und nonverbal – gehören beim Zuhören zusammen.“
Wir schlagen auf einer Obstbaumwiese ein Picknick auf, stärken uns mit unserem Proviant und frisch gepflückten Mirabellen, bevor wir auf unsere Route zurückkehren. Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir uns auf das gemeinsame Schweigen geeinigt haben – meine sozialen Batterien sind durch die Überhitzung wie lahmgelegt. Und so gehe ich mal wieder meinen Gedanken nach; über das Zuhören und das Gehört werden, was unser Redeverhalten über uns als Menschen, unsere Beziehungen zueinander und die Strukturen einer Gesellschaft aussagt.
Zwischen Achtsamkeit und Macht
Bereits Konfuzius im alten China betonte die Relevanz einer bewussten Auseinandersetzung mit dem, was wir erleben, sehen und vor allem hören. Die französische Sozialrevolutionärin Simone Weil betrachtete Aufmerksamkeit als „Gebet“ und als sowohl spirituelle, als auch revolutionäre Grundlage, während der Philosoph Michel Foucault die Frage, wer innerhalb einer Gesellschaft Diskurse führt und im Umkehrschluss andere zum Schweigen bringt, auf Machtverhältnisse und Ausschlussmechanismen zurückführt. Auch Margarete Imhof erkennt in unserem Rede- und Hörverhalten die Manifestation sozialer Rollen und Hierarchien. „In einer Zeit, in der es darauf ankommt, den eigenen Standpunkt direkt, laut und unmissverständlich heraus zu posaunen, ist Zuhören nicht gefragt. Wer ‚das Sagen‘ hat, ist Chef*in, wer ‚das Zuhören‘ hat, ist meistens irgendwie untergeordnet“, erklärt sie.
Wenn Stille zur Herausforderung wird
Sich in die Rolle des Zuhörers zu begeben, praktiziert Beerstecher in seinen „kontemplativen Dyaden“, einer Übung, die er auch mit mir durchführen möchte. Nach einem sogenannten „Slow Walk“ – einer Gehmeditation, bei der pro Atemzug nur ein Schritt nach vorne erfolgt – lassen wir uns auf einem schattigen, mit Wildblumen übersäten Wiesenstück am Rhein nieder.
Wir schauen uns für einen ungewohnt langen Zeitraum in die Augen, bis er mir mit einem Nicken signalisiert, dass ich anfangen könne, zu sprechen. Also beginne ich zu erzählen, irgendetwas, das mir gerade in den Sinn kommt. Bis ich nach etwa 30 Sekunden verstumme – und feststelle, dass ich mich nicht bereit fühle, mich über diesen Punkt hinweg zu öffnen. Nicht direkt zu hören, was mein Gegenüber über meine Gedanken denkt, wie es das Gesagte – und somit auch mich als Person – einordnet und bewertet, löst ein seltsames Gefühl von Unsicherheit in mir aus. Ich suche nach Anzeichen der Wertung in Beerstechers Gesichtsausdruck, doch er entgegnet mir nur ein ermutigendes Lächeln. Vermutlich benötigt es Übung, sich selbst die Erlaubnis zu erteilen, zu reden, ohne von unmittelbaren Reaktionen bestätigt zu werden. „Beim Sprechen macht man ja immer wieder die Erfahrung, dass das Gegenüber nicht aufs Erste vollständig versteht. Es erzeugt auf die Dauer Stress und Unbehagen bei der sprechenden Person, wenn sie nicht einschätzen kann, ob das zuhörende Gegenüber gedanklich bei der Sache ist und sich um Verständnis bemüht“, erklärt Margarete Imhof, als ich ihr die Erfahrung im Nachhinein schildere. Trotzdem sei es in der Praxis oftmals der Fall, dass Menschen mit ihren verbalen Rückmeldungen unreflektiert auf die Schiene der Bewertung, Besserwisserei oder Selbstdarstellung geraten – und dem Redefluss des Gegenübers dadurch eher schaden, als ihn zu fördern. „Daher ist der Leitsatz ‚Shut up and listen!‘ als Einstieg in ein gutes Zuhören hilfreich, aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss“, fügt sie hinzu. Wie es Beerstecher als Zuhörer dabei geht, schildert er mir in seiner Mail: „Wenn man nicht spontan lossprechen kann, dann hat man schon ein viel größeres Bewusstsein darüber, was man wirklich mitteilen möchte“, schreibt er. Insbesondere merke er durch seine Stille, welche impulsiven Reaktion und Floskeln à la „Alles wird gut“ man einfach weglassen könne.
Das Schweigen als Spiegelbild
Wir schließen die Wanderung mit unserer Ankunft am Seegrundstück ab. In einem Schub von Energie springt Beerstecher ins Wasser und verursacht damit vermutlich das lauteste Geräusch, das er am heutigen Tag von sich gegeben hat. Auch ich genieße das kühle Wasser auf meiner Haut, bevor ich mich auf den Weg zum Bahnhof mache. Als ich (ausgestattet mit acht Mückenstichen, klebriger Kleidung und einem Gefühl, das sich zwischen Entspannung und Erschöpfung bewegt) am Gleis stehe und Beerstecher ein letztes Mal zuwinke, reflektiere ich die heutigen Geschehnisse. Auf eine ungewöhnliche Art und Weise, ganz ohne ausgesprochene Worte, habe ich einen neuen Menschen kennengelernt. Doch vielmehr als das habe ich etwas über mich selbst herausgefunden: Beerstechers Schweigen zwingt sein Gegenüber dazu, in sich zu gehen. Und herauszufinden, bis zu welchem Punkt man dazu bereit ist, seine intimsten Gedanken zu teilen, wenn der Zuhörende weder Urteile und Ratschläge, noch Zwischenfragen und Orientierung entgegnet. Sein Schweigen hält der redenden Partei den Spiegel vor: Es zeigt, was zurückbleibt, wenn sprachliche Resonanz auf lautlos gestellt wird.